Eingangsbereich
Herzlich willkommen beiTolerant statt ignorant 2.0eine Erweiterung der virtuellen Ausstellung für Demokratie und gegen Antisemitismus
Innerhalb der Ausstellung findest du vielfältige Informationen und interaktive Materialien. Du kannst selbst entscheiden, welchen Raum du betrittst und welche Objekte du dir genauer anschauen möchtest. Durch Scrollen und Wischen kannst du die einzelnen Inhalte anschauen. Auf vielen Bildern siehst du helle Kreise, hier kannst du weitere Informationen zu den Bildern und Inhalten einsehen.
Zur Orientierung hilft dir die Übersicht am rechten Bildrand und die Hinweisschilder in der Ausstellung.
Wenn du nicht am Computer sitzt, drehe dein Tablet oder Smartphone für eine optimale Ansicht.
Viel Spaß beim Erkunden der Ausstellung!
Impressum
Hier findest du das Impressum.
Datenschutz
Hier findest du Informationen zum Datenschutz.
Unterrichtsmaterial
Hier finden Sie zu Raum 1, Raum 2, Raum 5 und Raum 6 begleitendes Unterrichtsmaterial.
Impressum
Impressum
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e. V.
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
Internet: www.jugend-und-bildung.de
Vertretungsberechtigte
Dr. Alexander Jehn (Präsident)
Michael Jäger (Geschäftsführer)
Verlag
Eduversum GmbH
Taunusstraße 52
65183 Wiesbaden
Telefon: (0611) 50 50 92 00
Fax: (0611) 50 50 92 55
Internet: www.eduversum.de
Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Wiesbaden
Registernummer: HRB 25555
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27a Umsatzsteuergesetz:
DE260102330
Verbraucherstreitbeilegung (§ 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG))
Zuständige Verbraucherschlichtungsstelle in Deutschland ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes - Zentrum für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, Tel.: 07851/7957940,
E-Mail: support(at)universalschlichtungsstelle.de.
Es besteht weder Verpflichtung noch Bereitschaft zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.
Hinweis nach § 36 VSBG: Es besteht keine Bereitschaft und keine Verpflichtung zur Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle.
Verantwortlich für die Inhalte (§ 55 Abs. 2 RStV):
Michael Jäger, Taunusstraße 52, 65183 Wiesbaden
Konzept, Projektleitung und Redaktion
Charlotte Höhn (verantwortlich), Minalde Wagner, Tabea Schwinn
E-Mail: redaktion@jugend-und-bildung.de
Fachliche und pädagogische Beratung
Dr. Alexander Jehn (Direktor der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung), Dr. Klaus Bott (Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus), Dr. Christopher Dietz (Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus), Daniel Janssen (Hessisches Informations- und Kompetenzzentrum gegen Extremismus), Annika Nord (Kultusministerium Hessen), Gottfried Kößler, Manfred Levy (Jüdisches Museum Frankfurt), Ann-Christin Wegener (Landesamt für Verfassungsschutz Hessen)
Redaktionsschluss
Dezember 2022
Texte
Yasmin Rosengarten, Linus Birrel, Raquel Erdtmann
Rechtshinweis
Wir sind Anbieter im Sinne der §§ 55 Absatz 1 RStV, 5 Absatz 1 TMG. Alle Inhalte dieser Internetseite www.tolerant-statt-ignorant.de sorgfältig erarbeitet und recherchiert. Diese Informationen sind ein Service der Arbeitsgemeinschaft Jugend und Bildung e.V. Alle Informationen dienen ausschließlich zur Information der Besucher des Onlineangebotes. Im Übrigen ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Es wurde Wert daraufgelegt, zutreffende und aktuelle Informationen bereitzustellen. Gleichwohl können Fehler auftreten. Die Anbieter weisen darauf hin, dass die Informationen auf den Webseiten allgemeiner Art sind, die nicht auf die besonderen Bedürfnisse im Einzelfall abgestimmt sind. Die Anbieter übernehmen keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Dies gilt auch für Informationen auf externen Webseiten, die über Links mit dieser Webseite verbunden sind.
Copyright-Hinweis
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Internetseiten anderer Betreiber. Das Einrichten von Links auf diese Homepage ist jedoch ausdrücklich gestattet.
Haftung für Links
Mit dem Urteil vom 12. September 1999 – 312 O 85/99 – Haftung für Links – hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mitzuverantworten hat. Dieses kann – so das Landgericht – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt daher: Der Betreiber hat keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten! Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Internetpräsenz und machen uns deren Inhalte nicht zu eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Internetpräsenz angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner und Links führen. Wir sind für den Inhalt solcher Seiten Dritter grundsätzlich nicht verantwortlich.
Über den Raum
Antisemitismus war in Deutschland nie verschwunden
Noch immer stellt Antisemitismus eine Bedrohung für unsere Gesellschaft dar. Antisemitismus unterscheidet sich von anderen Formen der Diskriminierung dadurch, dass er mehr als Vorurteile und Stereotype, sondern eine grundlegende Haltung zur Welt und eine bestimmte Weltanschauung darstellt. Antisemitismus richtet sich gegen Personen und Gruppen, die als „jüdisch“ wahrgenommen und denen zumeist negative Eigenschaften zugeschrieben werden, gegen religiöse Einrichtungen und jüdische Gemeinden. Er äußert sich in Hass, Anfeindungen, Benachteiligung, aber auch direkter Gewalt.
Antisemitische Stereotype und Feindbilder sind langlebig und werden wieder und wieder recycelt. Über Jahrhunderte haben sich Judenfeindschaft und die Beweggründe dahinter stets gewandelt. In der Antike und im Mittelalter wurde die Judenfeindschaft noch religiös begründet (mehr dazu hier). Es entstanden allerlei Legenden und Mythen mit dem Ziel, das Judentum vom Christentum abzugrenzen. Juden hätten etwa angeblich die Brunnen vergiftet und damit die Pest verursacht. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich der moderne Antisemitismus und eine neue Legende entstand: die „jüdische Weltverschwörung“, die nach der Herrschaft und Unterdrückung der Nichtjuden streben würde (mehr dazu hier). Bis heute spielt die Behauptung, Jüdinnen und Juden hätten eine angebliche Übermacht in der Politik und Wirtschaft, eine zentrale Rolle in einer antisemitischen Weltanschauung. Eine weitere Form der Judenfeindschaft, der Antizionismus, richtet sich gegen die Existenz des jüdischen Staates. Antizionismus richtet sich nicht gegen Jüdinnen und Juden als einzelne Personen, sondern gegen den Staat Israel. Das erlaubt seinen Anhängern, Antisemitismus weit von sich zu weisen.
Antisemitismus äußert sich im Alltag auf vielfältige Weise. Seien es Drohungen und Hasskommentare im Internet, die Verbreitung von antisemitischen Bildern in Musik und Medien oder tatsächliche Gewalt. Antisemitismus ist keine auschließlich rechte Randerscheinung. In der breiten Gesellschaft trifft man auf antisemitische Einstellungen und Aussagen, etwa in Form angeblicher Kritik an Israel oder der Verharmlosung des Holocaust. Welche Erfahrungen machen Jüdinnen und Juden in Deutschland? Welche Bedeutung spielt Antisemitismus in ihrem eigenen Alltag?
Datenschutz
Datenschutz
Wir verpflichten uns zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wie auch zur Transparenz darüber, welche Daten wir über Sie erfassen und zu welchem Zweck wir diese verwenden.
Um den neuesten Änderungen in der Datenschutzgesetzgebung auf Basis der am 25. Mai 2018 europaweit in Kraft tretenden Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) zu entsprechen und unsere Verpflichtung zur Transparenz aufzuzeigen, haben wir unsere Datenschutzerklärung aktualisiert.
Am Umgang mit Ihren Daten ändert sich dabei jedoch grundsätzlich nichts. Wenn Sie genauere Einzelheiten erfahren möchten, schauen Sie sich unsere Datenschutzrichtlinien an unter: https://jugend-und-bildung.de/datenschutz/
Kontaktadresse für datenschutzrelevante Anfragen:
redaktion@jugend-und-bildung.de
Antisemitische Vorfälle der letzten Jahre
Antisemitische Vorfälle der letzten Jahre
In der jährlichen Polizeistatistik werden viele gegen hier beheimatete Juden und jüdische Einrichtungen gerichtete Straftaten als „politisch motiviert“ oder als „Protest gegen die Politik Israels“ erfasst. In den letzten Jahren nehmen verbale Angriffe auf Jüdinnen und Juden wie Drohmails, Sachbeschädigung und Angriffe auf offener Straße zu. Die Anzahl der gemeldeten Vorfälle steigt – viele werden aber nicht angezeigt. Die Gründe sind vielfältig. Nach einer Studie der EU zu „Diskriminierung und Hasskriminalität gegenüber Jüdinnen und Juden“ (2019) gaben 39 Prozent der Befragten an, in den letzten fünf Jahren Opfer von antisemitischer Belästigung gewesen zu sein. Die Mehrheit, fast 80 Prozent, meldete die Vorfälle nicht bei der Polizei. Nahezu die Hälfte meldete die Vorfälle nicht, da sie das Gefühl hatte, dass sich dadurch nichts ändern würde, oder sie den jeweiligen Vorfall für nicht ausreichend schwerwiegend sah. Antisemitismus ist allgegenwärtig, etwa in Raptexten, die den Holocaust verharmlosen, Beleidigungen sowie Bedrohungen im Alltag oder auch dann, wenn auf Demonstrationen antisemitische Parolen gerufen werden.
Wie antisemitisch ist Deutschland?

Denkanstoß: Die Mehrheit der Befragten stimmen der Aussage zu, dass Juden genau so seien wie alle anderen. Doch zeitgleich bejahen bis zu 40 Prozent der Befragten antisemitische Aussagen, Vorurteile und Stereotype. Wie passt das zusammen und wie kann es zu diesen widersprüchlichen Ergebnissen kommen?
Terroranschlag in Halle
Der Anschlag erschütterte die gesamte Gesellschaft und rückte die Bedrohung von Antisemitismus erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie nahmen Jüdinnen und Juden den Anschlag und die darauffolgende Aufmerksamkeit wahr?
Das Wichtigste ist, dass wir keine Angst habenAvital, 23 Jahre, ist Vorstandsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und sagt über den Anschlag in Halle:
Ich bin damit aufgewachsen, dass jüdische Institutionen selbstverständlich bewacht werden, dass vor jeder jüdischen Institution, ob Kindergarten oder Synagoge, Sicherheitspersonal steht. […] Das Wichtigste ist, dass wir keine Angst haben. Angst macht fahrlässig, aber wir müssen achtsam sein. Ich will mich nicht wegekeln lassen aus meinem Heimatland. Gleichzeitig kann ich verstehen, wenn jüdische Menschen sich unsicher fühlen und enttäuscht sind. Für mich ist Wegziehen keine Lösung. Auch wenn an einem Tag wie heute die Rede nur von dieser Tat ist, bewegt uns mehr als Antisemitismus.“
„Junge Jüdinnen nach Anschlag in Halle: ‚Ich will mich nicht wegekeln lassen aus meinem Land‘“, Artikel vom 10. Oktober 2019 von ze.tt
Über den Raum
Geschichte des jüdischen Lebens in Hessen
Bis zur bürgerlichen Gleichstellung lebten Jüdinnen und Juden in den Städten in geschlossenen Siedlungen. In Frankfurt wurde zum Beispiel 1462 die Judengasse errichtet. Hier lebten Jüdinnen und Juden bis 1796. Nach deren Auflösung im frühen 19. Jahrhundert siedelten sie sich im ganzen Stadtgebiet an, die Ärmeren zogen in das benachbarte Ostend. Die berühmte Rindswurst von Gref-Völsing ist übrigens eine Kreation für die jüdische Kundschaft gewesen.
Es bildeten sich nun auch größere Gemeinden in Hessen. Juden unterstützten soziale Stiftungen, Bildungseinrichtungen und die Kultur. So entstanden zum Bespiel in Frankfurt durch das Engagement jüdischer Bürger die Universität, der Palmengarten, der Hauptbahnhof, die Alte Oper, das Clementinen-Kinderkrankenhaus und die Frankfurter Allgemeine Zeitung wurde gegründet. Die jüdischen Inhaber der Schuhfabrik Schneider waren die alleinigen Sponsoren der Eintracht Frankfurt bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. 1933 zählte die jüdische Gemeinde circa 30.000 Mitglieder, rund sieben Prozent der Bevölkerung Frankfurts. Damit war sie prozentual die größte Gemeinde in Deutschland. Als die amerikanische Armee 1945 Frankfurt befreite, lebten nur noch etwa 100 Juden in der Stadt.
Über den Raum
Was bedeutet es, jüdisch zu sein?
Die religiösen Grundlagen und Gebote, Traditionen und Bräuche spielen im Alltag und der Lebenswelt von Jüdinnen und Juden eine unterschiedliche Rolle. Die Auseinandersetzung mit einem gerechten Miteinander sowie der sich umgebenden Welt und Natur sind dagegen oftmals fest im Leben verankert. Woraus bestehen die zentralen Inhalte des Judentums?
Der folgende Raum verschafft dir einen Überblick über die Verbreitung des Judentums, dessen religiöse Grundlagen sowie einen Einblick in moralische, ethische Fragen, mit denen sich das Judentum beschäftigt. Wodurch zeichnet es sich aus, „jüdisch“ zu sein? Welche religiösen Aspekte liegen dem Judentum zugrunde und welche Rolle spielt das im Alltag und in der allgemeinen Lebensplanung?
Ausstellungsraum 3
Erfahrungen junger Jüdinnen und Juden
Wo begegnet Jüdinnen und Juden heute Antisemitismus?
Jüdische Siedlungsgeschichte im Mittelalter
Jüdische Gemeinden

Denkanstoß: Kennst du die Geschichte der jüdischen Gemeinde in deiner Stadt oder deinem Dorf?
Judentum weltweit
Judentum weltweit

Die hier abgebildeten Angaben umfassen aber nur die offiziellen Mitglieder der jüdischen Gemeinden. Jüdinnen und Juden, die nicht Teil einer Gemeinde sind, können in den Statistiken nicht erfasst werden.
War das schon immer so?

Entwicklung in einzelnen Ländern

Wer glaubt was?

Bei einer Gesamtbevölkerung von 85 Milionen Menschen in Deutschland, gehören sie einer Minderheit an. Die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland ist Mitglied in den christlichen Kirchen. Doch auch die Zahl der Konfessionslosen ist in Deutschland vergleichsweise hoch.
Vom Großen zum Kleinen

Denkanstoß: Was bedeutet es, christlich, muslimisch oder jüdisch zu sein? Welche Rolle spielt Religion für dich und deine Familie in deinem und euren Alltag?
Wie reagiert man auf Antisemitismus
Wie reagiert man auf Antisemitismus?
Was kannst du unternehmen?
Sollte dir Antisemitismus begegnen oder du bist selbst Opfer geworden, kannst du dir Hilfe suchen. Was du tun kannst und wo du dir Hilfe suchen kannst:
www.report-antisemitism.de: Meldeportal des Bundesverbands der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e. V.
www.response-hessen.de: Beratungsstelle für Betroffene rechter Gewalt in Hessen.
www.rote-linie.de: „Rote Linie – Hilfen zum Ausstieg vor dem Einstieg“ bietet Hilfestellung für potenziell gefährdete Jugendliche, die drohen in den organisierten Rechtsextremismus abzudriften. Zudem bietet sie Hilfe bei Hassrede und Mobbing im Internet.
www.ofek-beratung.de/hessen: „OFEK e. V. – Beratungsstelle bei antisemitischer Gewalt und Diskriminierung“ bietet lokale Unterstützungsangebote in Hessen für Einzelpersonen, Familien und Angehörige sowie Zeuginnen und Zeugen bei antisemitischer Gewalt an.
www.hessengegenhetze.de
Meldestelle für Hetze und Hass im Internet. Du kannst den Vorfall auch anonym und online melden.
Ausstellungsraum 4
Jüdische Migrationsbewegung nach 1945 und 1989/90
Jüdische Migrationsbewegungen nach 1945 und 1989
Displaced Persons: Menschen, die während des Zweiten Weltkrieges verschleppt oder deportiert worden waren und sich nach der Befreiung durch die Alliierten außerhalb der Grenzen ihrer Heimatländer befanden. Darunter fallen z. B. Zwangsarbeiter, (meist jüdische) Überlebende der Konzentrationslager sowie politische Gefangene und Kriegsgefangene der Nationalsozialisten und ihrer Verbündeten.
Displaced Persons

Migrationsbewegung nach 1990

Religiöse Grundlagen
Religiöse Grundlagen
Eine Beschäftigung mit dem Judentum geht über die religiösen Grundlagen hinaus. Die Frage, ob das Judentum bloß eine Religion oder eine Nation oder Volk sei, wird unterschiedlich beantwortet. Jüdinnen und Juden in Deutschland und auf der Welt bilden ebenso wenig wie Christen und Muslime eine einheitliche Gemeinschaft.
Welche Rolle spielen Bräuche, Traditionen und Feste im Leben (junger) Jüdinnen und Juden? Was unterscheidet das Judentum von anderen Religionen und was verbindet diese?
Halacha: (aus dem Hebräischen halach: „gehen“, „wandeln“) Die Gesamtheit jüdischen Rechts, das das Verhältnis des Volkes zu Gott und unter seinen Mitgliedern regelt, heißt „Halacha“, was mit „Lehre vom rechten Lebenswandel“ übersetzt werden kann.
Die Heilige Schrift
Die Heilige Schrift des Judentums ist der Tanach. Er besteht aus drei Teilen und umfasst 39 Bücher. Einen besonderen Stellenwert nimmt der erste Teil der Heiligen Schrift ein, die Tora. Sie ist unterteilt in die fünf Bücher Mose. Der Name „Tora“ bedeutet „Lehre“, kann aber auch mit „Gesetz“ übersetzt werden. Sie ist das erste Buch einer monotheistischen Religion und bildet den Mittelpunkt des jüdischen Glaubens. Die Schrift enthält Berichte über die Schöpfung, über Moses und dessen Begegnung mit Gott, die Geschichte des Volkes Israel und dessen Wanderungen. Sie umfasst unter anderem 613 Weisungen, beziehungsweise Gebote und Verbote.
Lernen durch Wiederholung
Im Alltag war es notwendig, die Tora und deren Regelungen immer wieder aufs Neue zu interpretieren und zu kommentieren, zu erklären und in Kontext zu setzen. Daher enthält der Talmud auch die Gemara. Das sind von Gelehrten über Jahrhunderte beigefügte Kommentare zu den Gesetzen und religiösen Traditionen.
Denkanstoß: Das Judentum ist die älteste monotheistische Weltreligion. Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zum Beispiel zum Christentum und Islam?
Das Judentum kennt viele Feste
Das Judentum konzentriert sich auf das Leben auf der Erde. Es gibt eine eigene jüdische Zeitrechnung und einen eigenen Jahreskalender, der sich nach dem Mond ausrichtet: So ist das jüdische „Jahr null“ nach gregorianischer Zählung das Jahr 3761 v. Chr. und auch Monate werden anders gezählt. Das jüdische Neujahr ist im Herbst (Tischri) und endet mit dem Monat Elul.
Jüdische Feste und Feiertage richten sich nach dem jüdischen Kalender. Wie feiern Jüdinnen und Juden und welche Feste und Bräuche gibt es neben dem wöchentlichen Schabbat im Judentum?
An diesem Tag überdenkt man das Vergangene in Hinblick darauf, was man im neuen Jahr besser machen möchte. Gott sitzt während der Zeit bis Jom Kippur über die Menschen zu Gericht und bestimmt die „Schicksale“ der Menschen für das neue Jahr. Die Vorbereitung auf diesen Tag beginnt vier Wochen zuvor – ähnlich der christlichen Fastenzeit vor Ostern.
Zu Beginn des Neujahrsfestes und zum Ende von Jom Kippur wird das Schofarhorn – ein Widderhorn – geblasen, um Gott Anerkennung zu zeigen. Es erinnert an den Widder, den Abraham anstelle Isaaks für Gott opferte. Am Schabbat wird der Schofar nicht geblasen.
Rosch ha-Schana
Das Neujahrsfest, Rosch ha-Schana,
ist ein hoher Feiertag im Judentum. Das neue Jahr beginnt mit dem Wunsch, sich
mit Gott und seinen Mitmenschen zu versöhnen. Der Feiertag liegt jedoch nicht
im Januar – der erste Monat des jüdischen Kalenders ist der Tischri. Im Jahr
2021 wird das Neujahrsfest am 7./8. September gefeiert werden.
An diesem Tag überdenkt man das Vergangene
in Hinblick darauf, was man im neuen Jahr besser machen möchte. Gott sitzt
während der Zeit bis Jom Kippur über die Menschen zu Gericht und bestimmt die „Schicksale“
der Menschen für das neue Jahr. Die Vorbereitung auf diesen Tag beginnt vier
Wochen zuvor – ähnlich der christlichen Fastenzeit vor Ostern.
Jom Kippur
Nach zehn Tagen folgt auf das
Neujahrfest der Versöhnungstag Jom
Kippur. An diesem Tag ergeht das göttliche Urteil, auf das sich die
Gläubigen mit Fasten und Büßen einstellen. Jom Kippur ist einer der wichtigsten
Feiertage im Judentum, an denen Gott bereute Sünden vergibt.
Zu Beginn des Neujahrsfestes und
zum Ende von Jom Kippur wird das Schofarhorn – ein Widderhorn – geblasen, um
Gott Anerkennung zu zeigen. Es erinnert an den Widder, den Abraham anstelle
Isaaks für Gott opferte. Am Schabbat wird der Schofar nicht geblasen.
Pessach
Das Pessachfest ist ein Wallfahrtsfest. Es
erinnert
an den Auszug der Israelis aus Ägypten. Das Fest erwuchs aus dem nomadischen
Brauch, im Frühjahr ein Lamm zu schlachten.
Schawout
50 Tage nach dem Pessachfest wird das Erntefest Schawuot gefeiert. Die Gerste ist abgeerntet und die Weizenernte beginnt. Außerdem feiert die jüdische Gemeinde die Übergabe der Tora.
Sukkot
Das Sukkotfest, auch Laubhüttenfest genannt, findet fünf Tage nach Jom Kippur statt und dauert acht Tage. Als ursprüngliches Erntedankfest erinnert es in jüdischer Tradition an die provisorischen Behausungen während der 40-jährigen Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste.
Chanukka
Das Lichterfest Chanukka dauert acht Tage und findet im Monat Kislew (Dezember) statt. An diesen Feiertagen wird der Einweihung des Tempels in Jerusalem nach dem siegreichen Makkabäeraufstand (164 v. Chr.) gedacht. Der Erzählung nach brannten die Lichter des Tempels auf wundersame Weise acht Tage lang fast ohne Lampenöl. In Erinnerung daran hat der Chanukkaleuchter acht Arme. Chanukka feiert mit der Einweihung des Tempels auch den Erhalt jüdischer Identität unter schweren Bedingungen.
Purim
Purim ist ein Freudenfest, das im Monat Adar (Februar oder März) gefeiert wird. Es gedenkt der Rettung des jüdischen Volkes durch Esther. Sie wurde von ihrem Cousin, dem jüdischen Mordechai, großgezogen und heiratete den König von Persien. Das ermöglichte ihr, ihr Volk vor dem Plan des hohen Regierungsbeamten Haman, alle Juden in Persien zu ermorden, zu retten. An Purim wird aus dem Buch Mose und Esther gelesen und jede Nennung des Namen Hamans wird durch Rasseln und andere laute Geräusche übertönt.
Von besonderer Bedeutung ist die „Brit Mila“, die Beschneidung männlicher Säuglinge am achten Lebenstag. Auch Juden, die sich nicht mehr als religiös bezeichnen, halten an der Beschneidung fest. Die Beschneidung markiert den Bund mit Gott und den Eintritt in die jüdische Gemeinschaft.
Brit Mila
Neben Feiertagen gibt es
traditionelle Feste, die Jüdinnen und Juden im Lauf ihres Lebens feiern, etwa
die Geburt, das Erreichen der religiösen Volljährigkeit oder die Hochzeit.
Von besonderer Bedeutung ist die
„Brit Mila“, die Beschneidung männlicher Säuglinge am achten Lebenstag. Auch
Juden, die sich nicht mehr als religiös bezeichnen, halten an der Beschneidung
fest. Die Beschneidung markiert den Bund mit Gott und den Eintritt in die
jüdische Gemeinschaft.
Bar Mizwa
Jungen erreichen mit 13 Jahren im Rahmen der Bar-Mizwa ihre religiöse Volljährigkeit. Am Schabbat nach ihrem Geburtstag wird ihre Aufnahme in der Synagoge gefeiert, wo sie zum ersten Mal aus der Tora vorlesen.
Bat Mizwa
Mädchen in liberalen Gemeinden
feiern mit zwölf Jahren ihre Volljährigkeit im Rahmen der Bat-Mizwa. Im
Anschluss folgt eine Feier.
Denkanstoß
Die Bar-Mizwa bzw. die Bat-Mizwa stellt für junge Jüdinnen und Juden den Übergang in die religiöse Volljährigkeit dar, sie sind fortan ein vollwertiges Mitglied der jüdischen Gemeinde. Kennst du ähnliche Rituale?
Alles eine Verschwörung?
Alles eine Verschwörung?
Seit Jahrhunderten wird ihnen beispielsweise zugeschrieben, im Geheimen Böses zu tun, zu betrügen oder etwa umfassende Kontrolle über Politik, Finanzen und die Medien zu haben. Besonders in Krisenzeiten erleben solche Erzählungen immer wieder neuen Auftrieb. Im Mittelalter erklärte etwa der christliche Antijudaismus das Aufkommen der Pest damit, dass Juden die Brunnen vergiftet hätten. Der Präsident der palästinensischen Autonomiebehörde Abbas beschuldigte Israel, das in Palästina zu tun - vor dem EU-Parlament und bekam Beifall für seine Rede (2016). Dass das „internationale Finanzjudentum“ nach der Weltherrschaft strebe, ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts der verbreitetste Mythos. Aktuell bietet die Covid-19-Pandemie fruchtbaren Boden für antisemitische Verschwörungserzählungen.
Theorie, Erzählung, Mythos oder Ideologie?
Weitverbreitet ist der Begriff „Verschwörungstheorie“. Dieser täuscht aber eine theoretische, wissenschaftliche Grundlage vor, was nicht zutrifft. Viele sprechen daher von Verschwörungserzählungen. Das soll verdeutlichen, dass es sich lediglich um eine Annahme handelt, die nicht nachvollziehbar ist. Eine Verschwörungserzählung erscheint in sich schlüssig und jeder rationale Einwand wird als Bestätigung angesehen. Um Verschwörungserzählungen zu erkennen, kann man fragen: Von wem kommt die Erzählung, was ist ihre Intention und gibt es eine andere, rationale Erklärung?
Verschwörungsideologie hingegen beschreibt ein Denksystem, ein Weltbild. Kritik und Widerspruch an diesem wird ausgeschlossen. Trotz widerlegender Beweise wird die Ideologie aufrechterhalten, da der Glaube an eine Verschwörung so weit gefestigt ist. Existierende Gruppen wie Geheimdienste oder wohlhabende Familien werden als Verschwörer inszeniert.
Der Verschwörungsmythos bezieht sich nicht wie die Ideologie auf existierende Gruppen oder Einzelpersonen, sondern auf fiktive Personen oder Gruppen. Hierunter zählen etwa die Mythen über Reptiloide oder die Illuminati.
Jüdische Erinnerungsorte in Hessen
Jüdische Erinnerungsorte in Hessen
Das Ostend
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts entstand im Osten der Stadt Frankfurt ein neues Wohngebiet. Es siedelten sich zunächst überwiegend Arbeiter an. Doch nach der Öffnung der Frankfurter Judengasse siedelten viele Jüdinnen und Juden in dem Viertel an. Ende des 19. Jahrhunderts war fast jeder zweite Bewohner im „Ostend“ jüdisch. Es gab zahlreiche jüdische Geschäfte und Wohlfahrtseinrichtungen wie das jüdische Waisenhaus.
Synagoge in der Friedberger Anlage
Durch jüdische Einwanderer aus Ost- und Mittelosteuropa war das Leben im Ostend vor allem durch das orthodoxe Judentum geprägt. Die orthodoxe Gemeinde errichtete zu Beginn des 20. Jahrhunderts an der Friedberger Anlage ihre Synagoge. Diese wurde von den Nationalsozialisten in der Reichspogromnacht 1938 zerstört und ein Bunker wurde an ihrer Stelle errichtet. Heute findet sich hier ein Ausstellungsraum, der die Geschichte des Ostends beleuchtet.
Battonstraße
Denkanstoß: Gibt es bei dir im Ort einen jüdischen Friedhof und kennst du dessen Geschichte?
Rothschildpalais
Denkanstoß: Suche nach Berührungsorten in deiner Umgebung und recherchiere deren Geschichte.
Ausstellungsraum 1
Moral und Ethik
Moral und Ethik
Wie selbstbestimmt sind wir? Welche Folgen hat unser eigenes Handeln auf uns selbst und das Zusammenleben mit anderen und die Natur? Solche Überlegungen können und werden dir in deinem Alltag immer wieder begegnen. Eine allgemeingültige Antwort ist schwer zu finden, schließlich ändert sich unsere Welt stetig und althergebrachte Ansichten müssen immer wieder aufs Neue durchdacht werden. Im Zentrum der jüdischen Ethik stehen Gerechtigkeit, Wohltätigkeit, Güte und Mitgefühl. Welche Antworten gibt das Judentum auf heutige moralische und ethische Fragen?
Noachidische Gebote
Noachidische Gebote: Die sieben Gebote umfassen das Verbot von Mord, Diebstahl, Götzenanbetung, Unzucht, Verzehr von Fleisch eines lebenden Tieres, Gotteslästerung sowie die Einführung von Gerichten, um die Einhaltung der Gesetze zu gewähren.
Wie frei ist unser eigener Wille?
Die Frage nach der Willensfreiheit wird von vielen Menschen seit je diskutiert. So meinen einige Philosophen, Wissenschaftler und Denker zum Beispiel, dass alle Entscheidungen vorherbestimmt sind – durch vorherige Ereignisse, natürliche Triebe oder aber auch die Allwissenheit Gottes. Inwiefern die Willensfreiheit etwa durch die Allmacht und Allwissenheit Gottes eingeschränkt ist, wird auch im Judentum diskutiert. Der Philosoph Maimonides zum Beispiel erklärte, dass die menschliche Vernunft und das Handeln eine Gabe Gottes seien. Das ermöglicht uns, frei von Trieben, eigenen Bedürfnissen und äußeren Einflüssen zu entscheiden. Vielmehr basiere das Handeln auf Werten und Idealen. Demnach sind Menschen in ihrem Willen frei, eigene Entscheidungen zu treffen.
Denkanstoß: Was bedeutet „freier Wille“ für dich? Können Menschen einen freien Willen haben und welche Rolle spielt hierbei die Religion?
Bal Taschchit
Die jüdische Lehre vertritt den moralischen Grundsatz, dass sich der Mensch die Natur zwar zu nutzen machen darf, doch ebenso für deren Erhalt sorgen muss. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur schließt zum Beispiel Umweltzerstörung und Verschwendung von natürlichen Ressourcen aus. Der Grundsatz „Bal Taschchit“ („Vernichte nicht!“) bezieht sich etwa auf die Verschwendung von Lebensmitteln, insbesondere von Obstbäumen. Frühe Auslegungen erweitern die Bedeutung auch auf andere Formen der mutwilligen Zerstörung und sinnlosen Verschwendung, wie von Lampenöl, Kleidung oder Tieren.
Es liegt in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, der Zerstörung von natürlichen Ressourcen und der Verschwendung entgegenzuwirken, die Natur zu bewahren und durch das eigene Handeln zu verbessern. An Tu Bischwat, dem Neujahrsfest der Bäume, werden zum Beispiel Bäume gepflanzt.
Denkanstoß: Bal Taschchit wird oft als Verbot der Verschwendung von allerlei Ressourcen ausgelegt. Was könnte dies alles beinhalten, welche weiteren Beispiele fallen dir ein?
Darf ich Israel kritisieren?
Darf ich Israel kritisieren?
Palästina erzählt die Geschichte wechselhafter Eroberungen
Bereits 1917 versprach Großbritannien einerseits die Errichtung einer jüdischen Heimstätte in Palästina, andererseits aber auch ein arabisches Königreich von Palästina bis an den Persischen Golf sowie ein Königreich Großsyrien. Doch Palästina wurde nach dem Ersten Weltkrieg ein Mandatsgebiet unter britischer Führung.
Die jüdische Besiedelung Palästinas nahm weiter zu. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 strömten immer mehr Jüdinnen und Juden nach Palästina und kauften dort Land. Aus Sorge vor Konflikten beschränkte die britische Mandatsmacht die jüdische Zuwanderung. Auf beiden Seiten gründeten sich paramilitärische Organisationen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnten zum einen die Briten ihre Mandatsherrschaft nicht mehr aufrechterhalten und zum anderen wurde das Ausmaß des Holocaust bekannt. Daraufhin beschloss die UNO 1947, die Region in ein jüdisches und ein palästinensisches Land aufzuteilen. 1948 erklärte Israel seine Unabhängigkeit und das weltweite Judentum erhielt einen eigenen Staat.
Doch mit dem Aufteilungsplan der UNO war keine Seite zufrieden. Innerhalb kürzester Zeit kam es zum Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten, die die Gründung des Staates ablehnten. Dieser Konflikt prägt die Region bis heute und es kommt immer wieder zu Ausschreitungen. 1993 kam es zu Friedensgesprächen, in denen beide Seiten ihr jeweiliges staatliches Existenzrecht anerkannten. Seitdem werden bestimmte Gebiete von einer Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet.
"Juddebubbe"
„Juddebubbe“ – die Eintracht Frankfurt
Auch die Geschichte des hessischen Sportvereins Eintracht Frankfurt ist ohne die jüdischen Bürger der Stadt undenkbar. Neben jüdischen Unterstützern spielten in der Mannschaft selbst einige Juden. So war die Schuhfabrik J. & C. A. Schneider der jüdischen Inhaber Adler und Neumann vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten der wichtigste Sponsor und ermöglichte dem Verein seinen Aufstieg. Doch auch der Frankfurter Verein schloss jüdische Sportlerinnen und Sportler im Lauf der 1930er-Jahre aus und galt ab 1937 als „judenrein“. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden sämtliche Sportvereine von den Alliierten aufgelöst und die Vereine mussten sich neu gründen.
Jüdische Sportvereine
Einer der bedeutendsten ist bis heute „Makkabi“, der 1903 von deutsch-jüdischen Vereinen als Dachverband gegründet wurde. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde der Dachverband zunächst aus dem Sport ausgeschlossen und wenige Jahre darauf verboten. 1965 wurde Makkabi Deutschland wieder neu gegründet. Der Frankfurter Ortsverein ist heute mit über 1.000 jüdischen und nichtjüdischen Mitgliedern der größte Ortsverein.
(Foto: B1-Fussballjugend des juedischen Sportklubs Makkabi in Frankfurt am Main, 2018)
Die Eintracht Frankfurt
Klicke auf den Kreis und schaue dir das Interview an.
Sport im Nationalsozialismus
Bis 1933 konnten Juden weitestgehend
unbehelligt Sport ausüben. Doch mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam
es zu umfassenden Veränderungen im deutschen Sport und Juden wurden aus dem
Wettbewerb mit nichtjüdischen Vereinen ausgeschlossen. Der Sport im
Nationalsozialismus sollte am Militär und Wehrdienst ausgerichtet sein. Er sei
„die Vorbildung für den späteren Heeresdienst“.
Harry Valérien: Sport in der Hitler-Jugend
Harry Valérien war Mitglied der Hitlerjugend und später Sportjournalist. Er beschreibt die Bedeutung von Sport im Nationalsozialismus besonders für Jugendliche.
Klicke auf den Kreis und schaue dir das Interview an.
Die Eintracht im Nationalsozialismus
„Die unterzeichnenden, am 9. April 1933 in Stuttgart anwesenden, an den Endspielen um die süddeutsche Fußballmeisterschaft beteiligten Vereine des Süddeutschen Fußball- und Leichtathletikverbandes stellen sich freudig und entschieden den von der nationalen Regierung auf dem Gebiet der körperlichen Ertüchtigung verfolgten Besprechung zur Verfügung und sind bereit, mit allen Kräften daran mitzuarbeiten. Sie sind gewillt, in Fülle dieser Mitarbeit alle Forderungen, insbesondere in der Frage der Entfernung der Juden aus den Sportvereinen, zu ziehen. Sie betrachten es ferner als vaterländliche Pflicht, den Wehrsport in ihr Jugenderziehungsprogramm aufzunehmen. Stuttgarter Kickers, Karlsruher FV, Phönix Karlsruhe, Union Böckingen, FSV Frankfurt, Eintracht Frankfurt, 1. FC Nürnberg, SpVgg Fürth, SV Waldhof, Phönix Ludwigshafen, Bayern München, 1860 München, FC Kaiserslautern, FC Pirmasens“ „Unser Verein ist judenfrei! Ausgrenzung im deutschen Sport“, hrsg. v. Lorenz Pfeiffer u. Henry Wahlig, Berlin/Boston 2017, Dok. 267 „Stuttgarter Erklärung führender süddeutsche Fußballvereine zur ‚Entfernung der Juden aus den Sportvereinen‘“
1933 tritt er aus seinem Verein aus und kommt dem Ausschluss zuvor. Ab 1939 muss er Zwangsarbeit verrichten. Er wird zunächst nicht deportiert da er mit einer Nicht-Jüdin verheiratet ist. 1943 wird er nach Auschwitz deportiert. 1950 wird er offiziell für tot erklärt.
Ab 1911 spielt er in der Nationalmannschaft. Während der Olympischen Spiele 1912 stellte er gegen Russland ein Tor-Weltrekord auf, er schoss in einem Länderspiel zehn Tore. 1920 beendet er offiziell seine Fußballkarriere. Aus seinem Sportverein wurde er 1935 als Jude ausgeschlossen. Zwei Jahre später emigriert er nach Kanada, wo er 1972 verstarb.
Sein Tor-Weltrekord von 1912 wurde erst 2001 gebrochen.
1928, nach ihrem Vereinswechsel, nimmt die an den Olympischen Spielen teil. Sie gewinnt mehrere Titel, wie Deutsche Speerwurfmeisterin. Ab 1931 trainiert sie die britische Leichtathletikmannschaft. Zwei Jahre darauf zieht sie nach London, da die antisemitische Diskriminierung immer weiter zunimmt.
Walther Bensemann
Walther Bensemann wurde am 13. Januar 1873 in Berlin geboren und gilt als deutscher Fußballpionier. Er war an zahlreichen Vereinsgründungen etwa in Straßburg, Baden-Baden, München, Marburg und Freiburg beteiligt – darunter auch die der Eintracht Frankfurt. Zudem begründete er die noch heute bekannte Fußballzeitung „Kicker“. Er vertrat die Idee, dass Fußball friedensstiftend wirken könne und die Menschen unabhängig von Klasse und Herkunft verbinde. Nach der Machtübernahme floh er 1933 in die Schweiz und verstarb dort am 12. November 1934.
Denkanstoß
Walther Bensemann sah im Sport die Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Herkunft zu verbinden: „Der Sport ist eine Religion, ist vielleicht heute das einzig wahre Verbindungsmittel der Völker und Klassen.“ – Stimmst du dem zu? Wie integrativ kann Sport wirken?
Helene Mayer
Helene Mayer wurde am 20. Dezember 1910 als Tochter eines jüdischen Arztes in Offenbach am Main geboren. Im Alter von zehn Jahren trat sie dem Fechtclub Offenbach bei und wurde mit 14 Jahren Deutsche Meisterin im Florettfechten. Sie hielt diesen Titel fünf Jahre in Folge. 1928 gewann sie in Amsterdam die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen und wurde weltweit bekannt.
Olympische Spiele
Sie gehörte 1936 zu den wenigen Sportlerinnen mit jüdischen Wurzeln, die an den Olympischen Spielen teilnehmen durften, und gewann die Silbermedaille. Sie selbst sah sich jedoch nicht als Jüdin. 1937 emigrierte sie in die Vereinigten Staaten und erhielt 1940 die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie verstarb 1953.
Julius Hirsch
Julius Hirsch wurde am 7. April 1892 in Achern geboren. In seiner Karriere als Nationalspieler wurde er 1910 und 1914 zwei mal Deutsche Meister. Er ist der zweite jüdische Nationalspieler.
1933 tritt er aus seinem Verein aus und kommt dem Ausschluss zuvor. Ab 1939 muss er Zwangsarbeit verrichten. Er wird zunächst nicht deportiert da er mit einer Nicht-Jüdin verheiratet ist. 1943 wird er nach Auschwitz deportiert. 1950 wird er offiziell für tot erklärt.
Gretel Bergmann Lambert
Gretel Bergmann wurde 1914 in Laupheim geboren. Sie gehörte zu den besten Hochspringerinnen in Deutschland. Aufgrund ihrer jüdischen Herkunft wird sie bereits 1933 aus ihrem Sportverein ausgeschlossen. Daraufhin emigriert sie nach Großbritannien und plant für das britische Team an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Allerdings wird sie vom NS-Regime genötigt nach Deutschland zurückzukehren, um dort weiter zu trainieren - eine Teilnahme will das Regime jedoch verhindern. Obwohl sie sich durch einen neuen deutschen Rekord im Hochsprung qualifiziert hatte, verweigert man ihr die Teilnahme. Sie wandert in die USA aus und ist dort weiterhin aktiv im Sport. Ihr Hochsprungrekord wurde 2009 vom Leichtathletik-Verband offiziell in die Statistik erfasst.
Gottfried Fuchs
Gottfried Fuchs wurde am 3. Mai 1889 in Karlsruhe geboren und spielte seit klein auf Fußball. Mit seiner späteren Mannschaft (Karlsruher FV) wird er mehrmals Süddeutscher Meister.
Ab 1911 spielt er in der Nationalmannschaft. Während der Olympischen Spiele 1912 stellte er gegen Russland ein Tor-Weltrekord auf, er schoss in einem Länderspiel zehn Tore. 1920 beendet er offiziell seine Fußballkarriere. Aus seinem Sportverein wurde er 1935 als Jude ausgeschlossen. Zwei Jahre später emigriert er nach Kanada, wo er 1972 verstarb.
Sein Tor-Weltrekord von 1912 wurde erst 2001 gebrochen.
Martha Jacob
Martha Jacob, am 7. Februar 1911 in Berlin geboren, ist bereits als Fünfjährige Mitglied des Turnvereins Bar Kochba Berlin. Anfangs trainiert sie vor allem Turnen und Gymnastik doch entdeckt ab 1924 ihr Talent für Leichtathletik.
1928, nach ihrem Vereinswechsel, nimmt die an den Olympischen Spielen teil. Sie gewinnt mehrere Titel, wie Deutsche Speerwurfmeisterin. Ab 1931 trainiert sie die britische Leichtathletikmannschaft. Zwei Jahre darauf zieht sie nach London, da die antisemitische Diskriminierung immer weiter zunimmt.
Neugründung nach 1945
Arthur Cahn (ehemalige Spieler, Vorsitzender und Pressewart), der 1936 mit seiner Schwester nach Chile geflüchtet war, schrieb in einem seiner letzten Briefe 1952 an seine alten Vereinskameraden: „Ihr Eintrachtler, lasst euch nicht zerbrechen, fördert nach wie vor das Wahre, Gute und Schöne, helft der gewillten und befähigten Jugend, die Tradition zu erhalten, und schätzt den Geist und den zähen Willen der Alten und Ältesten, die zum Wiederaufbau stehen, und grüßt mir mein schönes Frankfurt und meine Eintracht.“
Jüdische Vielfalt
Ist jüdisch gleich jüdisch?
Im Judentum gibt es wie auch in anderen Religionen verschiedene Strömungen, die durch verschiedene geografische, kulturelle und politische Rahmenbedingungen geprägt wurden und sich in ihren Bräuchen, Traditionen und auch ihrer Sprache unterscheiden. Ca. 70. n. Chr. wurde Jerusalem durch die Römer zerstört und das jüdische Volk vertrieben. Die ins heutige Spanien (biblischer Name „Sefardim“) ausgewanderten Jüdinnen und Juden nannten sich Sefardim und erlebten während der muslimischen Herrschaft ab 709 vier „goldene Jahrhunderte“, in denen sie enorme Fortschritte in Wissenschaft und Kultur erzielten. Im 15. Jahrhundert wurden sie aus Spanien vertrieben. Sie lebten daraufhin vor allem im Osmanischen Reich, aber auch in Italien, Frankreich oder Nordafrika.
Im frühen Mittelalter siedelten sich viele Juden in Mittel- und Nordeuropa an, zum Beispiel in den Gebieten des Heiligen Römischen Reichs. Sie nannten ihr Siedlungsgebiet Aschkenas und sich selbst Aschkenasim. Viele zogen jedoch aufgrund von Judenfeindschaft oder Verfolgungen weiter Richtung Ostmittel- und Osteuropa. Darüber hinaus unterteilt sich das Judentum in viele weitere Strömungen. Welche Ausrichtungen gibt es und wie gestaltet sich das Zusammenleben?
Das liberale Judentum
Doch es verweist auch auf die Pflicht, historische Vorstellungen aufzugeben und die vom Menschen niedergeschriebenen Schriften und Gebote anzupassen. Jüdische Tradition soll mit moderner Kultur in Einklang gebracht werden. Im liberalen Sinn bedeutet jüdisch zu sein, sich in der persönlichen Lebenswelt für die Schöpfung, die Gerechtigkeit zwischen den Menschen und den Erhalt von Frieden einzusetzen.
Das orthodoxe Judentum
Orthodox: Der Begriff stammt aus dem Griechischen und bedeutet „rechtgläubig“.
Judentum, Christentum, Islamein Gott - drei Kinder
Dennoch zeigt die Geschichte, dass ein friedliches Miteinander möglich ist. Im spanischen Mittelalter schufen zum Beispiel jüdische Schriftgelehrte und forschungsfreudige Muslime eine wissenschaftliche und kulturelle Blütezeit, von der Europa bis heute profitiert.
Ausstellungsraum 2
Über den Raum
Antisemitismus hat Geschichte
Aus der Existenz von Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft in verschiedenen Erscheinungsformen leitet sich die Verantwortung ab, die Bedeutung des Erinnerns an den Holocaust und die strukturelle Diskriminierung von Jüdinnen und Juden für unser Zusammenleben zu betonen. Sie mahnt vor den Folgen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, vor der Gefahr, die von Stereotypen und Diskriminierung religiöser oder ethnischer Gruppen ausgeht, und zeugt von der Bedeutung des Schutzes von Minderheiten.
Holocaust: Der Begriff stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet „vollständig verbrannt“ und steht für den Völkermord an den europäischen Juden. Der Begriff Shoah stammt aus dem Hebräischen und bedeutet „Unheil“ oder auch „Katastrophe“.
"Das mutierende Virus"Am 27. September eröffnete der britische Rabbi Lord Jonathan Sacks im Europäischen Parlament die „Konferenz zur Zukunft der jüdischen Gemeinden in Europa“.
(Deutsche Übersetzung bereitgestellt von Audiatur Online)
Deutsch-jüdische Geschichte
Deutsch-jüdische GeschichteZwischen Anpassung und Isolation
Doch kennzeichnete die Vertreter der europäischen Aufklärung ein gespaltenes Verhältnis zum Judentum. So fordern die Ideale der Aufklärung zwar Toleranz und Gleichberechtigung, doch gleichzeitig wurde das Judentum als eine rückständige Religion angesehen. Zudem führten die Bemühungen nach rechtlicher Gleichstellung und gesellschaftlicher Akzeptanz letztlich auch zu Diskussionen um die jüdische Identität und zu einer Spaltung der jüdischen Gemeinde. Welche Streitpunkte standen im Mittelpunkt der jüdischen Aufklärung? Welche jüdischen Einflüsse gab es im 19. Jahrhundert?
Jüdische Aufklärung
Die Ideen der europäischen Aufklärung beeinflussten das Judentum und führten zu einem Wandel der Selbstwahrnehmung vieler Jüdinnen und Juden. Vertreter der jüdischen Aufklärung wie der jüdische Philosoph Moses Mendelssohn forderten eine kulturelle Anpassung an die christliche Umwelt und eine Modernisierung der jüdischen Religion und Gesetze: Jüdinnen und Juden sollten sich aus ihrer traditionellen Welt hinausbewegen ohne jedoch ihre eigene Religion gänzlich aufzugeben.
Toraübersetzung
Im Jahr 1783 veröffentliche Mendelssohn eine deutsche Übersetzung der Tora. Sie bot vielen jiddischsprachigen Jüdinnen und Juden die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Er beabsichtigte damit, das Judentum für die Bildung und Kultur zu öffnen und dessen gesellschaftliche Integration zu fördern.
Israel Jacobson
Der Bankier und Rabbiner Israel Jacobson (1768‒1828) setzte sich für die Interessen jüdischer und christlicher Benachteiligter ein. Er errichtete zum Beispiel eine Schule, die später auch von christlichen Schülern besucht wurde.
Reformgottesdienst
1810 eröffnete Jacobson den Jacobstempel mit dem ersten jüdischen Reformgottesdienst, der auf Deutsch gehalten und von Chorgesang und Orgel begleitet wurde. Die Angleichung von Judentum und Christentum mit dem Ziel eines gemeinschaftlichen Fortschrittes zum Besseren hatte er sich, von Mendelssohn beeinflusst, auf die Fahnen geschrieben. Die Idee des Reformgottestdienst breitete sich bis nach Nordamerika aus.
Kritik an Anpassung
1812 - Preußisches Judenedikt
Im Zuge weitreichender Reformen verlieh der preußische Staat den jüdischen Bewohnern im Jahr 1812 den Bürgerstatus. Obwohl dies mit einer Gleichstellung an Rechten und Pflichten verbunden war, beinhaltete dies nicht das Recht zum Staatsdienst in Verwaltung, Justiz oder dem Offizierskorps. Dennoch brachten Juden ein Jahr später ihr staatsbürgerliches Verständnis zum Ausdruck, indem sie sich in den Befreiungskriegen gegen Frankreich als Freiwillige meldeten.
Auszug der ostpreußischen Landwehr ins Feld 1813
Der Maler Gustav Graef inszenierte dies in der Mitte des 19. Jahrhunderts rückblickend in seiner Darstellung Auszug der ostpreußischen Landwehr ins Feld 1813, indem er einen sich von seinen Eltern verabschiedenden jüdischen Freiwilligen im rechten unteren Vordergrund prominent in Szene setzte.
Zwischen Anpassung und Ausgrenzung
Doch trotz der rechtlichen Gleichstellung und Errungenschaften stießen Jüdinnen und Juden auf Vorurteile und blieben noch lange stark benachteiligt – etwa an den Universitäten oder im Staatsdienst.
Albert Einstein
Der Nobelpreisträger Albert Einstein (1979‒1955) gilt als einer der bedeutendsten Physiker. Bereits 1905 veröffentlichte er seine ersten Arbeiten zur Relativitätstheorie. Und auch zur Quantenphysik leistete er wesentliche Beiträge. 1934 wurde er aus dem Deutschen Reich ausgebürgert, seine Schriften wurden im nationalsozialistischen Deutschen Reich verbrannt.
Hannah Arendt
Die Philosophin und politische Theoretikerin Hannah Arendt (1906‒1975) gilt noch heute als eine der größten politischen Denkerinnen. In ihren Werken analysierte sie diktatorische und totalitäre Regime. 1961 kommentierte sie den Prozess gegen Adolf Eichmann, der die Deportation der europäischen Jüdinnen und Juden organisiert hatte, und prägte den Begriff der „Banalität des Bösen“.
Moritz Daniel Oppenheim
Moritz Daniel Oppenheim (1800‒1882) gilt als „erster jüdischer Maler“, der eine akademische Ausbildung genoss und weltweit bekannt war. Er malte vor allem Porträts jüdischer Persönlichkeiten und Historienbilder. Viele seiner Bilder widmeten sich dem jüdischen Leben und der Frömmigkeit, aber auch der Identitätsbildung und dem Patriotismus. Besondere Berühmtheit erlangte er durch seine Bilder zu jüdischen Fest- und Feiertagen.
Else Lasker-Schüler
Else Lasker-Schüler (1869‒1945) war eine deutsch-jüdische Schriftstellerin und zählt zu den bedeutendsten expressionistischen Lyrikerinnen. Sie wurde nicht nur als Dichterin, sondern auch als Zeichnerin bekannt.
Theodor Herzl
Theodor Herzl (1860‒1904) studierte in Wien und arbeitete anschließend als Korrespondent bei einer Wiener Zeitung. Er war Schriftsteller, Publizist und Journalist. Im Jahr 1896 veröffentlichte er das Buch „Der Judenstaat“, indem er seine Meinung zur Notwendigkeit der Gründung eines jüdischen Staates beschreibt. Er starb 44 Jahre bevor Israel schließlich gegründet wurde.
Rahel Hirsch
Rahel Hirsch (1870‒1953) war eine deutsch-jüdische Ärztin. Sie arbeitete zunächst nach Abschluss ihres Pädagogikstudiums in Wiesbaden als Lehrerin. 1903/04 promovierte sie im Fach Medizin und arbeitete an der Berliner Charité. Im Jahr 1913 wurde sie als erste Frau in Deutschland zur Professorin der Medizin ernannt.
Paul Ehrlich
Der Mediziner Paul Ehrlich (1854‒1915) gilt als Begründer der Chemotherapie. Er entwickelte unter anderem eine Behandlung gegen Syphilis. Seinen Arbeiten zur Immunität bereiteten große Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen dar.
Sigmund Freud
Sigmund Freud (1856‒1939) ist der Begründer der Psychoanalyse. Seine entwickelte Traumdeutung dient der Erforschung des Unbewussten. Er unterteilte die menschliche Psyche in das „Es“ (Bedürfnisse und Triebe), das „Ich“ (kritischer Verstand) und das „Über-Ich“ (Gebote und Verbote). Noch heute werden seine Methoden angewandt und kritisch diskutiert.
Antijudaismus
Christlicher Antijudaismus
Diaspora: Das altgriechische Wort „diasporá“ bedeutet „Zerstreuung“. Der Begriff bezeichnet hier das Leben der jüdischen Minderheit unter vielen Andersgläubigen und verweist auf die Vertreibung nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Jüdinnen und Juden lebten „in der Welt zerstreut“. Heute trifft der Begriff für viele der in Deutschland geborenen und aufgewachsenen Jüdinnen und Juden nicht mehr zu und Deutschland ist ihre Heimat.
Gottesmord: Der Vorwurf reicht zurück bis ins Jahr 160 und geht zurück auf die Schriften des Bischofs Melito von Sardes. Jüdinnen und Juden wird eine angebliche unaufhebbare Schuld an der Kreuzigung Jesus, der als Sohn Gottes gesehen wird, zugeschrieben. Dieser Verschwörungsmythos ist im christlichen Antijudaismus zentral und wird über Jahrhunderte hinweg immer wieder aufgegriffen und verbreitet.
1. Kreuzzug
Mit der Ausdehnung des Christentums im Mittelalter verbreiteten sich auch judenfeindliche Vorurteile und Stereotype. Als im Jahr 1096 Papst Urban II. zum Kreuzzug aufrief, um das Heilige Land von Feinden des Christentums zu befreien, kam es zu Pogromen an Jüdinnen und Juden. Die Massen wurden angetrieben von weitverbreiteten Vorurteilen und Verschwörungserzählungen. Sie galten als Gottes- bzw. Christusmörder, Hostienschänder oder Brunnenvergifter. Allein in Mainz und Worms fielen etwa 2.000 Menschen den Pogromen zum Opfer. Die Ereignisse stellen einen Einschnitt für das jüdische Leben dar.
Zeitgenössische Darstellung des Judenhuts
Die jüdische Bevölkerung im Mittelalter wird oftmals mit bestimmten Kennzeichnungen abgebildet wie zum Beispiel dem trichterförmigen „Judenhut“. Diese Kopfbedeckung fand vor allem Einzug in zeitgenössische Darstellungen und kennzeichnete jüdische Männer. Diese Darstellungen prägen bis heute das Bild von Juden im Mittelalter. Eine Pflicht zum Tragen solch eines Hutes gab es nicht. Eine offizielle, allgemeine Kennzeichnungspflicht wie der „Gelbe Fleck“ wurde hingegen erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts durchgesetzt, in Frankfurt zum Beispiel 1462.
Wandmalerei
Die hier abgebildete Wandmalerei aus der Katharinenkapelle in Landau (Pfalz) aus dem 14. Jahrhundert bildet die Kreuzigung Jesus durch einen als Juden gekennzeichneten Mann ab und transportiert den antijüdischen kirchlichen Vorwurf des „Gottesmordes“.
Wohnen im Mittelalter
In den Städten im Heiligen Römischen Reich siedelten sich bestimmte Personengruppen oder auch Berufsgruppen in jeweiligen Wohnvierteln an. Auch jüdische Gemeinden ließen sich in einzelnen Straßen oder ganzen Stadtvierteln nieder. Jüdinnen und Juden lebten jedoch nicht gänzlich abgeschottet von ihrer christlichen Umwelt außerhalb der Stadtmauern in abgeschlossenen Wohnvierteln. Mittelalterliche Judengassen oder -viertel waren nicht gänzlich abgegrenzt und über mehrere Jahrhunderte lebten Juden und Christen zusammen.
Frankfurter Judengasse
Die zum Teil abgeschlossenen Wohnbezirke entstanden erst Ende des 15. Jahrhunderts. Eines der bekanntesten Beispiele ist die 1462 errichtete Frankfurter Judengasse. Die gesonderte Unterbringung versprach den jüdischen Frankfurtern zwar ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht, war aber mit einer Vielzahl weiterer Beschränkungen verbunden.
Pestpogrome
Mit Ausbruch der Pest kam es in Europa zu unzähligen Ausschreitungen gegen die jüdische Bevölkerung. Ihnen wurde unter anderem vorgeworfen, die Brunnen und das Trinkwasser vergiftet zu haben, sie wurden zum Sündenbock erklärt und seien verantwortlich für die nicht aufzuhaltende Pest.
Zahlreiche jüdische Gemeinden wie Worms, Köln, Mainz, Trier und Koblenz wurden zerstört. An vielen Orten kam es zu Auschreitungen noch bevor die Pest sich bis dahin ausbreitete. und beendete das friedliche Zusammenleben schlagartig.
Wucherjuden?
Seit dem Mittelalter ist das Stereotyp des „reichen Juden“ oder auch „Wucherjuden“ bis heute verbreitet. Dies geht darauf zurück, dass angeblich durch das Verbot des Zinshandels für Christen vor allem Juden als Geldleiher arbeiteten. Die christliche Kirche verurteilte zwar den Geldhandel und die Verschuldung von Christen, doch konnte sie nie ein rechtliches allgemeines Zinsverbot für Christen aussprechen.
Holzschnitt 1531
Durch berufliche Einschränkungen im Mittelalter, beispielsweise das Verbot, Mitglied einer Handwerkszunft zu sein, gab es im Vergleich zu christlichen viele jüdische Geldverleiher. Doch die Mehrheit der jüdischen Bevölkerung arbeitete überwiegend im Handel. Darstellungen wie dieser Holzschnitt verbreiteten das Vorurteil des „reichen Juden“.
Alles koscher?
Speiseregeln und GeboteAlles koscher?
In vielen Religionen gibt es Speiseregeln. Sie geben vor, welche Lebensmittel gegessen oder auch wie diese zubereitet werden dürfen. Die jüdischen Speiseregeln heißen „Kaschrut“ („rituelle Einigung“). Lebensmittel werden in koschere („rein“, „geeignet“) und nicht koschere bzw. „treife“ unterteilt. Darüber hinaus gibt es aber auch „neutrale“ Lebensmittel. Darunter fallen pflanzliche Lebensmittel wie Obst, Gemüse und Getreide. Die Speiseregeln beziehen sich jedoch nicht nur auf Lebensmittel – auch die Herstellung von Textilien oder der Umgang und die Schlachtung von Tieren werden beispielsweise beschrieben. Was beinhalten die jüdischen Speisevorschriften und welchen Hintergrund haben sie? Was darf gegessen werden und worauf sollte verzichtet werden? Gibt es Gemeinsamkeiten zu anderen Weltreligionen?
Fleischverzehr
Viele religiöse Speiseregeln beziehen sich auf den Fleischverzehr. So ist es im Christentum geboten, freitags Fisch zu essen. Im Islam gilt Schweinefleisch als unrein und Hinduisten verzichten auf Rindfleisch. Im Judentum dürfen ebenfalls nicht alle Tiere verzehrt werden. Wiederkäuer mit gespaltenen Hufen wie Kühe, Meerestiere mit Schuppen und Flossen oder auch Vögel außer Greifvögeln gelten als koscher und sind erlaubt. Damit scheiden Wild, Krustentiere, fleischfressende Tiere und viele andere aus.
Milch und Fleisch
Besonders in Bezug auf sogenannte milchige und fleischige Lebensmittel gibt es einige Regeln. Milch und Fleisch dürfen etwa weder zusammen gekocht, aufbewahrt noch gegessen werden. So haben etwa viele Kühlschränke zwei Bereiche für milchige und fleischige Lebensmittel oder es wird unterschiedliches Geschirr genutzt.
Weinlese
Nicht nur Lebensmittel selbst unterliegen Speiseregeln – auch die Zubereitung bestimmter Produkte wird in den Kaschrut geregelt. So muss etwa Wein, der koscher sein soll, von Juden angebaut und gekeltert sein. Damit die Weinlese als koscher gilt, wird ein Zehntel des Weines geopfert und auf die Erde gegossen.
Unnötiges Leid vermeiden
Die Vorschrift „Za’ar Ba’alei Chaim“ verbietet es, lebenden Tieren unnötiges Leid zuzufügen. Die Tora verbietet jedoch nicht den Verzehr von Fleisch. Unter Befolgung genauer Anweisungen, insbesondere in Bezug auf die Schlachtung, ist der bedachte Verzehr gestattet. Da das Blut der Schlachttiere nicht verzehrt werden darf, müssen Tiere auf eine bestimmte Art und Weise geschlachtet werden. Das sogenannte Schächten soll dazu dienen, dass das Fleisch kein Tierblut mehr enthält.
Garantiert koscher
Antisemitismus im 19. Jahrhundert
Entstehung des modernen Antisemitismus
Doch die Frage nach der rechtlichen Gleichstellung und die damit verbundenen Auseinandersetzungen änderten nichts an den Vorbehalten und der Diskriminierung gegenüber jüdischen Mitmenschen. Es entstand eine neue Form der Judenfeindschaft, die die vermeintlich wissenschaftlichen Theorien der sogenannten Rassenforschung nutzte. Der gesamten jüdischen Bevölkerung wurden negative Eigenschaften und eine angebliche Übermacht zugeschrieben.
Antijüdische Verbände
Viele Gegner der jüdischen Emanzipation organisierten sich in antisemitischen Vereinen, Verbänden und schließlich auch in Parteien. Allein zwischen 1815 und 1848 publizierten sie über 2.000 antisemitische Schriften zur sogenannten Judenfrage.
Hep-Hep-Auschreitungen
Der neu aufkeimende Antisemitismus gegen Jüdinnen und Juden mündete im 19. Jahrhundert in gewaltsamen Ausschreitungen. 1819 kam es zu den sogenannten Hep-Hep-Unruhen gegen die jüdischen Gemeinden zahlreicher Städte. Die Angriffe gingen überwiegend von Handwerkern, Händlern und auch Studenten aus. Juden wurden beschimpft, bedroht und misshandelt. Zum Teil wurden hierbei ganze Geschäfte und Synagogen zerstört. Die Ausschreitungen konnten nur durch den Einsatz der Staatsgewalt beendet werden.
Zeichnung
Zeichnung zu den Hep-Hep-Ausschreitungen in Frankfurt am Main von Johann Michael Voltz von 1819
Auch auf Postkarten wurden antisemitische Texte und Abbildungen abgedruckt, die Juden abwertend darstellten.
Antisemitische Postkarten aus dem Kaiserreich
Im Deutschen Kaiserreich waren antisemitische Vorurteile weitverbreitet. Antisemitische Karikaturen und Bilder wurden vielfach in Zeitungen und Flugblättern abgedruckt.
Auch auf Postkarten wurden antisemitische Texte und Abbildungen abgedruckt, die Juden abwertend darstellten.
Postkarte von 1901
Die angebliche "jüdische Weltverschwörung"
In den 1930er-Jahren kooperierte das nationalsozialistische Deutschland mit arabischen Nationalisten und bildete eine gemeinsame Front gegen Großbritannien und Frankreich. Sie zielten darauf ab, die Entstehung eines jüdischen Staates im damaligen britischen Mandatsgebiet Palästina zu verhindern. So gelang ein großer Teil des deutschen Antisemitismus auch in die arabische Welt. Propagandaschriften wie "Die Protokolle der Weisen von Zion" werden bis heute verbreitet.
Auch in heutigen Verschwörungserzählungen wird dieser Mythos aufgegriffen – nicht zuletzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie. Auf unzähligen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen werden antisemitische Codes genutzt und in historischen Vergleichen der Holocaust relativiert. So greifen beispielsweise im Mai 2020 in Stuttgart Demonstranten die angebliche jüdische Verschwörung auf.
Zionismus - eine Reaktion auf den Antisemitismus?
Zionismus: Der Name der jüdischen Nationalbewegung leitet sich vom Namen des Tempelbergs „Zion“ in Jerusalem ab.
Nationalsozialismus
Antisemitismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Im Parteiprogramm der 1920 in München gegründeten Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) spielten antisemitische Positionen von Beginn an eine prägende Rolle. Die Partei setzte sich für den Ausschluss von Juden aus der deutschen Bevölkerung und die Errichtung einer „Volksgemeinschaft“ ein. Adolf Hitler, ab 1921 Parteivorsitzender der NSDAP, knüpfte in seiner erstmals 1925 erschienenen Schrift "Mein Kampf" an bestehende antisemitische Verschwörungserzählungen an. Die jüdische Bevölkerung wurde einerseits als „minderwertig“ bezeichnet und zeitgleich als unmittelbare Bedrohung. Sie sei für die Übel des Kapitalismus sowie die des Kommunismus und die bolschewistischen Gewaltexzesse verantwortlich.
Die antisemitische Propaganda und Politik im Nationalsozialismus führten zu umfassender Diskriminierung und Ausschließung der Jüdinnen und Juden. Im Lauf des Zweiten Weltkriegs fielen über sechs Millionen Menschen der planmäßigen Verfolgung durch den deutschen Staat zum Opfer. Mit diesem Völkermord, häufig als Shoah oder Holocaust bezeichnet, erreichte der Antisemitismus seinen erschütternden historischen Höhepunkt.
Dolchstoßlegende
Nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg verbreitete sich hartnäckig der Mythos der „Dolchstoßlegende“. Demnach sei das deutsche Heer nicht im Kampf gefallen, sondern von der eigenen neuen Regierung nach der Novemberrevolution 1918 verraten worden. Jüdische Bürger wurden zur Zielscheibe von Anschuldigungen. Sie hätten sich vor dem Kriegseinsatz gedrückt, vom Krieg profitiert und seien für die Novemberrevolution und Niederlage verantwortlich.
Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
In Reaktion darauf gründeten jüdische Kriegsveteranen den Reichsbund jüdischer Frontsoldaten. Er widmete sich dem Andenken der jüdischen Gefallenen und der öffentlichen Anerkennung der von jüdischen Soldaten für Deutschland erbrachten Opfer.
Machtübernahme NSDAP
Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler im Januar 1933 wurde der moderne Antisemitismus deutsche Staatsdoktrin. Bereits wenige Monate später wurde die mit der Reichsgründung 1871 hergestellte rechtliche Gleichstellung der Juden aufgehoben. Jüdische Beamte und solche mit jüdischen Vorfahren verloren durch das neu eingeführte Berufsbeamtengesetz ihre Stellung.
Boykott
Ebenfalls im April 1933 führte die Regierung eine Aktion gegen das jüdische Leben in Deutschland durch, indem es für einen Tag den Boykott jüdischer Geschäfte und Dienstleistungen verordnete. Überall in Deutschland kam es infolge der Boykotte auch zu Plünderungen und Gewalt.
Nürnberger Gesetze
Die Nürnberger Gesetze im Jahr 1935 stellten die Grundlage für weitere Entrechtung und Verfolgungen von Jüdinnen und Juden dar. Sie unterteilten die Bevölkerung in sogenannte Deutschblütige, Mischlinge und Juden, entzogen Jüdinnen und Juden Teile ihrer staatsbürgerlichen Rechte und verboten Eheschließung und Geschlechtsverkehr zwischen Juden und Nichtjuden. Juden waren fortan Bürger zweiter Klasse.
Flucht vor Antisemitismus
Einige Familien mussten sich trennen, wieder anderen mangelte es an finanziellen Möglichkeiten zur Flucht. Für die meisten war das Exil der Schritt in eine unsichere und ungewisse Zukunft, für viele ein Trauma. Am zurückgelassenen Besitz und dem Vermögen der Ausreisenden bereicherten sich der deutsche Staat und die deutschen Banken. Auch Nachbarn und andere Interessierte bedienten sich am Besitz der Vertriebenen und später der Deportierten.
Warschauer Ghetto
Deportationen
Völkermord an europäischen Jüdinnen und Juden

Über den Raum
Zum AnfangSchoah
Shoah und das Gedenken
Die Ermordung und Vertreibung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland stellen bis heute einen wichtigen Bezugspunkt der heutigen Erinnerungskultur dar. Wie soll man mit der eigenen Vergangenheit umgehen und die Verbrechen und Geschehnisse ausarbeiten? Welche Verantwortung leitet sich daraus ab? Nicht zuletzt prägte die nationalsozialistische Vergangenheit die Entstehung und das Selbstverständnis der Bundesrepublik Deutschland und Israels. (Foto: Ministerpräsident David Ben-Gurion verliest die israelische Unabhängigkeitserklärung, 1948)
Erinnerungskulturen: Unter Erinnerungskulturen versteht man, inwiefern sich eine Gruppe, bzw. eine Gesellschaft oder ein einzelnes Individuum mit der Geschichte auseinandersetzt und an die Vergangenheit erinnert. Museen oder Gedenkstätten sind zentrale Orte der Erinnerung und für die Gesellschaft.
Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland
1945 gab es noch über acht Millionen NSDAP-Mitglieder. Sowohl in den west- als auch ostdeutschen Besatzungszonen fand unmittelbar nach Kriegsende die sogenannte Entnazifizierung statt. Diese Maßnahmen hatten zum Ziel, sämtliche verbliebenen nationalsozialistischen Einflüsse zu beseitigen.
Die 1949 gegründete Deutsche Demokratische Republik (DDR) bezeichnete sich als antifaschistische Gesellschaft. Somit versuchte sie, sich von den Verbrechen des Vorgängerregimes abzugrenzen, und eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit wurde deutlich erschwert. Die Bundesrepublik Deutschland verstand hingegen die umfangreiche Unterstützung Israels durch die BRD als Teil einer „Wiedergutmachung“.
Auschwitz-Prozess
Sechs der Angeklagten wurden zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt, elf erhielten Haftstrafen zwischen drei und 14 Jahren, drei weitere Angeklagte wurden freigesprochen. Die Prozesse führten bei vielen Menschen zum Umdenken im Umgang mit den Verbrechen. Die Prozesse stießen auch eine Debatte im Bundestag an, die letztlich dazu führte, die Verjährungsfrist von Mord aufzuheben.
Die Aufzeichnungen der Prozesse kannst du dir hier anhören.
Die Entstehung des Staates Israel
Gemeinsamer Wunsch nach einer jüdischen Heimstätte
Es formierte sich eine jüdische Nationalbewegung: der Zionismus. Die Anhängerinnen und Anhänger der zionistischen Bewegung forderten einen jüdischen Staat, in dem Jüdinnen und Juden selbstbestimmt und sicher leben können.
In der Folge von antisemitischen Gewaltakten und Pogromen, vor allem im Russischen Kaiserreich, flohen zahlreiche Jüdinnen und Juden nach Amerika oder wanderten nach Palästina aus, das damals zum Osmanischen Reich gehörte. Palästina war dünn besiedelt und so kauften Jüdinnen und Juden arabischen Großgrundbesitzern, die selbst nicht in Palästina lebten, Land ab und gründeten Siedlungen.
Die Entstehung des Zionismus
Die Entstehung des Zionismus

Wie entstand die zionistische Bewegung?

Noch bis ins 18. Jahrhundert konnten auch in Mitteleuropa Kaiser, Könige sowie Fürsten über Jüdinnen und Juden als eine Art Staatseigentum bestimmen, ihre Ansiedlung verbieten, einschränken und nach Gutdünken Regeln oder Gesetze über sie erlassen. Ebenso wurden sie in ihren beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten stark einschränkt. Bis ins 19. Jahrhundert waren Jüdinnen und Juden weitestgehend rechtlos.
In der Umbruchszeit vor dem Ersten Weltkrieg kam es im damaligen Russischen Kaiserreich und auf dem Gebiet des heutigen Polen zu einer Häufung von grausamen Pogromen gegen Jüdinnen und Juden.
Ganze Gemeinden wanderten infolgedessen nach Amerika oder Palästina aus.
Die jüdische Nationalbewegung des Zionismus sah die Schaffung eines eigenen Staates als einzige Chance für das jüdische Volk, jemals in Freiheit und selbstbestimmt leben zu können.
Sind alle Jüdinnen und Juden Zionistinnen und Zionisten? Ein Beitrag des Anne-Frank-Hauses klärt hier auf.

Der Weg zur Staatsgründung
Das Osmanische Reich zerfiel und Palästina wurde ein Mandatsgebiet unter britischer Führung. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 in Deutschland mussten immer mehr Jüdinnen und Juden nach Palästina fliehen. Das sorgte für zunehmenden Unmut unter der arabischen Bevölkerung und führte zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. So kam es auch in arabischen Staaten zu Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung. Sowohl auf jüdischer als auch auf arabischer Seite gründeten sich paramilitärische Organisationen.
Um die Konflikte einzudämmen, beschränkte die britische Mandatsmacht die jüdische Zuwanderung nach Palästina. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg konnten die Briten ihre Mandatsherrschaft nicht mehr aufrechterhalten und übergaben sie den Vereinten Nationen. Überfordert mit den vorherrschenden Zuständen, entschieden die Vereinten Nationen am 29. November 1947 mit ihrem Teilungsplan (Resolution 181), das britische Mandatsgebiet Palästina in einen arabischen und einen jüdischen Staat aufzuteilen.
Am 14. Mai 1948 proklamierte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident Israels, die Unabhängigkeit Israels und das Judentum erhielt seinen ersten eigenen Staat. Dieser Moment ist auf dem Bild festgehalten.
Unter König David, etwa im 10. Jahrhundert v. Chr., wurde Jerusalem Davidstadt genannt, die Hauptstadt des jüdischen Reiches. König Davids Sohn Salomo erbaute einen heiligen Tempel, in dem die Bundeslade mit den steinernen Tafeln der zehn Gebote aufbewahrt wurde. Unter der Herrschaft Herodes (73 v. Chr. bis 4 v. Chr.) wurde auf der steinernen Plattform ein prächtiger zweiter Tempel erbaut.
Die Römer unter Titus zerstörten im Jahre 70 den zweiten Tempel. Übrig blieb nur die mächtige Westmauer, heute als Klagemauer bekannt. Zum Abschluss vieler Gebete oder jedes Jahr an einem Trauertag gedenken Jüdinnen und Juden der Zerstörung des Tempels.
Nach Mekka ist Jerusalem der zweitheiligste Ort des Islams. Auf dem sogenannten Tempelberg wurde im 7. Jahrhundert der Felsendom errichtet. Von diesem soll der Prophet Mohammed in den Himmel geritten sein. Der arabische Name für Jerusalem und die prächtige Moschee auf dem Tempelberg lautet al-Quds, übersetzt: die Heilige.
Für das Christentum ist Jerusalem mit dem Wirken und der Kreuzigung Jesu verbunden. Die Grabeskirche in der Altstadt ist einer der heiligsten Orte des Christentums; hier soll Jesus gekreuzigt, beerdigt und wiederauferstanden sein.
Für jede der drei Weltreligionen hat Jerusalem eine besondere Bedeutung. Für Jüdinnen und Juden, die fast zweitausend Jahre keine politische Macht in der Region und in der Stadt hatten, blieb Jerusalem stets ein Sehnsuchtsort. Bis heute wünscht man sich zu Zeremonien oder Feiertagen „Nächstes Jahr in Jerusalem“.
Seit 2.500 Jahren ist Jerusalem mehrfach erobert, zerstört und wieder aufgebaut worden. In der engen, kleinen Altstadt gibt und gab es auch in den Jahrhunderten diverser Herrscher immer ein jüdisches, ein christliches und ein muslimisches Viertel. Um den Zugang zum Tempelberg und der Klagemauer aber wurde seit der Staatsgründung Israels gestritten. Immer wieder kommt es an dem so mit religiöser Bedeutung aufgeladenen Tempelberg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen.
Ausstellungsraum 5
Der Nahostkonflikt
Zwischen Unabhängigkeit und Katastrophe
Nachdem am 14. Mai 1948 offiziell der Staat Israel ausgerufen worden war, entstanden weitere Konfliktherde. So griffen noch in derselben Nacht sechs vereinigte arabische Armeen (Syrien, Ägypten, Transjordanien, Libanon, Irak, Saudi-Arabien) Israel an. Jordanien beanspruchte das Westjordanland für sich. Dies war ihnen einst von Großbritannien als Staatsgebiet versprochen worden. Ägypten besetzte den Gazastreifen, Syrien beanspruchte die Golanhöhen. Es ging nicht um ein eigenständiges Palästina, sondern um die Verhinderung eines jüdischen Staates zwischen den arabischen Nachbarstaaten.
Dieser erste Krieg wird in Israel Unabhängigkeitskrieg genannt – in den arabischen Staaten als Nakba, was übersetzt „Katastrophe“ bedeutet, weil Israel den Krieg gewann.
Der Völkerbund wurde im Jahr 1919 gegründet und hatte das Ziel weltweit Frieden zu sichern und gute internationale politische Beziehungen zu pflegen. Im Oktober 1945 lösten die Vereinten Nationen den Völkerbund in seinem Bestehen ab.
Über 400 Jahre (1516-1918) gehörte Palästina zum Osmanischen Reich und war unter türkischer Herrschaft. Während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917 besiegte das britische Truppen das türkische
Militär. Das Land Palästina wurde Mandatsgebiet von Großbritannien und stand fortan unter dessen politischen Vormundschaft. Dies wurde 24. Juli 1922 vom Völkerbund in London legitimiert.
Der Völkerbund wurde im Jahr 1919 gegründet und hatte das Ziel weltweit Frieden zu sichern und gute internationale politische Beziehungen zu pflegen. Im Oktober 1945 lösten die Vereinten Nationen den Völkerbund in seinem Bestehen ab.
Ein britischer Soldat kontrolliert die Papiere eines Arabers am Jaffa-Tor in Jerusalem im Jahr 1936.
Am 25. Januar 2006 gewann die Hamas mit absoluter Mehrheit die Wahlen in den Palästinensischen Autonomiegebieten. Dadurch entstand ein Konflikt zwischen den beiden großen Parteien. Dieser endete 2007 – seitdem kontrolliert die Hamas den Gazastreifen und die Fatah Teile des Westjordanladens.
Benannt nach Arthur Balfour, damals britischer Außenminister. Dieser versprach in seiner Erklärung vom 2. November 1917 eine „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ zu errichten.
Beschluss, auch Resolution genannt, der Generalversammlung der Vereinten Nationen (englisch: United Nations; kurz UN). Dieser sollte den territorialen Konflikt zwischen der arabischen und jüdischen Bevölkerung im britischen Mandatsgebiets Palästina beilegen.
Am Tag nachdem der UN-Teilungsplan für Palästina verabschiedet wurde, entbrannte ein gewalttätiger Konflikt zwischen arabischen Milizen und der israelischen Haganah. Als am 14. Mai 1948 David Ben-Gurion den Staat Israel ausrief, griffen die Armeen der arabischen Nachbarländer Syrien, Ägypten, Transjordanien, Libanon, Irak und Saudi-Arabien den neugegründeten israelischen Staat an.
David Ben-Gurion verkündete am 14. Mai 1948 die israelische Unabhängigkeitserklärung und begründete damit den modernen Staat Israel.
Die Haganah (hebräisch: Verteidigung) wurde 1920 gegründet und war eine jüdisch-zionistische Untergrundarmee während Palästina britisches Mandatsgebiet war. Später wurde aus ihr die israelische Armee.
Der Suezkanal ist ein Schifffahrtskanal in Ägypten und seit 1869 ein wichtiger Handelsweg. Am 26. Juli 1956 verstaatlichte der ägyptische Präsident Gamal-Abdul Nasser den Suezkanal. Doch damit brauch er internationales Recht, denn es war Gesetz, dass alle den Kanal frei passieren dürfen. Das löste die Suezkrise aus. Das Vorhaben führte dazu, dass militärische Truppen aus Großbritannien, Frankreich und Israel am Suezkanal einrückten. Die Vereinten Nationen, die USA und die UdSSR mussten deeskalierend einwirken.
Gründung der PLO auf Initiative des ägyptischen Präsidenten Gamal-Abdul Nasser während der Tagung des palästinensischen Nationalrats. Gründungsziel der PLO war es, eine Vertretung des arabischen Volkes in Palästina im Rahmen einer panarabischen Bewegung zu schaffen. Diese Bewegung hatte das Ziel einen großen arabischen Nationalstaat zu bilden.
Ägypten, Syrien und Jordanien bedrohten Israel mit militärischen Angriffen. Daraufhin reagierte Israel mit einem Präventivschlag und eroberte den Gazastreifen und Sinai-Halbinsel von Ägypten, das Westjordanland von Jordanien sowie die Golanhöhen von Syrien und schließlich Ostjerusalem.
Ägypten und Syrien beginnen einen Überraschungsangriff auf Israel an Jom Kippur, dem heiligsten jüdischen Feiertag. Israel verteidigt sich erfolgreich, bis es am 24. Oktober 1973 zum Waffenstillstand kam. Israel geht als Sieger hervor und muss keine Gebiete abtreten.
Basiert auf der Resolution 242 des UN-Sicherheitsrates, die nach dem Sechstagekrieg beschlossen wurde und zur Friedenssicherung im Nahen Osten beitragen sollte. Das Abkommen zwischen US-Präsident Jimmy Carter, dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin und dem ägyptischen Staatspräsidenten Anwar as-Sadat führt zum Israelisch-ägyptischen Friedensvertrag.
Der Libanonkrieg war ein militärischer Konflikt zwischen der israelischen Armee und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO), der im Libanon ausgetragen wurde. Denn die PLO hatte ihr Hauptquartier in der libanesischen Hauptstadt Beirut.
Israel begann nach dem Sechstagekrieg mit dem Bau von jüdischen Siedlungen in palästinensischen Gebieten. Gleichzeitig verschlechtert sich die soziale Situation vieler Palästinenserinnen und Palästinenser. Es gab hohe Arbeitslosigkeit und die Lebenssituation war für viele sehr prekär. Am 8. Dezember 1987 eskalierte die Lage und der „Krieg der Steine“, wie die erste Intifada auch genannt wird, begann. Die gewalttätige Auseinandersetzung zwischen Palästinenserinnen und Palästinenser und der israelischen Armee dauerte fast sechs Jahre.
Nach geheimen Friedensverhandlungen zwischen der israelischen Regierung und der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) unterzeichneten beide Parteien am 13. September 1993 das Abkommen Oslo I und am 24. September 1995 das Abkommen Oslo II. Mit den Vereinbarungen sollte die erste Intifada beendet und stufenweise der Frieden zwischen Palästina und Israel herbeigeführt werden. Beide Seiten erkannten ihr gegenseitiges Existenzrecht an und arbeiteten an Kompromissen, um den Nahostkonflikt friedlich beizulegen.
Für ihre Bemühungen um einen Frieden zwischen Israel und Palästina im Rahmen der Osloer Friedensverhandlungen erhielten Jassir Arafat, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Schimon Peres, Außenminister von Israel und Israels Premierminister Jitzchak Rabin den Friedensnobelpreis.
Der damalige Israelische Premierminister Jitzchak Rabin wird von jüdischem Fundamentalisten erschossen. Dadurch geriet der Friedensprozess ins Stocken.
Nach dem Tod von Premierminister Rabin kam es zum Stillstand im Osloer Friedensprozess. Es konnten keine Einigung oder keine Kompromisse gefunden werden, sodass die Lage im Nahen Osten erneut eskalierte und die zweite Intifada begann, die fast fünf Jahre dauern sollte. In dieser Zeit kam es zu unzähligen gewaltsamen Ausschreitungen und tödlichen Anschlägen durch militante Palästinensergruppen, die in Form von Selbstmordattentaten oder gelegten Explosionen in Cafés, Restaurants und Bussen verübt wurden.
Die USA, die Vereinten Nationen, die EU und Russland stellen als sogenanntes Nahostquartett einen Friedensplan vor, in dem die Gründung eines Staates Palästina in drei Phasen bis Ende 2005 geplant ist.
Mit der Umsetzung des sogenannten Abkoppelungsplans oder Scharon-Plans, initiiert durch den damaligen israelischen Ministerpräsidenten Ariel Scharon, wurden einige israelische Siedlungen im Gazastreifen geräumt.
In den Palästinensischen Autonomiegebieten (Gazastreifen, Teile des Westjordanlandes) gibt es bis heute zwei große Parteien: Die Fatah und die Hamas. Die Fatah wurde 1959 u. a. von Jassir Arafat gegründet. Zu Anfang war die Fatah eine militante und gewaltbereite Organisation, dann wandelte sie sich und hat heutzutage moderate Ansichten. Die Hamas entstand 1967 nach dem Sechstagekrieg als Ableger einer ägyptischen Muslimbruderschaft. Ihre Ideologie folgt religiös fundamentalistischen und panarabischen Grundsätzen.
Am 25. Januar 2006 gewann die Hamas mit absoluter Mehrheit die Wahlen in den Palästinensischen Autonomiegebieten. Dadurch entstand ein Konflikt zwischen den beiden großen Parteien. Dieser endete 2007 – seitdem kontrolliert die Hamas den Gazastreifen und die Fatah Teile des Westjordanladens.
Israel startet eine Militäroffensive gegen die im Libanon operierende Hisbollah (eine von Iran aus gesteuerte militante Organisation). Der Auslöser dafür ist die Entführung zweier israelischer Soldaten durch Mitglieder der Hisbollah.
Nach anhaltendem Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen startet Israel die Luftoffensive Gegossenes Blei gegen Einrichtungen und Mitglieder der Hamas. Israel erklärte am 18. Januar 2009 den einseitigen Waffenstillstand und beendete damit die Offensive.
Nach zweijähriger Pause nahmen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Palästinenserpräsident Mahmud Abbas wieder Friedenverhandlungen in Washington auf. Es kommt zum Abbruch von palästinensischer Seite, da Israel die palästinensische Forderung für eine Verlängerung des Baustopps für israelische Siedlungen im Westjordanland nicht akzeptiert.
Die Fatah und die Hamas unterzeichneten ein Versöhnungsabkommen, welches eine Übergangsregierung und Neuwahlen innerhalb eines Jahres vorsah.
Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas stellt bei den Vereinten Nationen einen Antrag auf Mitgliedschaft. Dieser scheitert jedoch wegen geringer Unterstützung aus dem UN-Sicherheitsrat. Dafür nimmt die UNESCO Palästina am 31. Oktober 2011 als das 195. Mitglied auf.
Nachdem israelische Städte aus dem Gazastreifen beschossen wurden, beginnt Israel Militäroperation Säulen der Verteidigung gegen das von der Hamas kontrollierte Gebiet. Erstmals seit Jahren wird gezielt ein Hamas-Militärführer getötet. Militante Palästinenserinnen und Palästinenser reagieren als Gegenreaktion mit Raketenbeschuss auf israelische Städte.
Erneut gerieten die Friedensgespräche zwischen Israel und Palästinenserinnen und Palästinensern ins Stocken. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas lehnte Kompromissvorschläge ab und warb um Beitritt zu 15 UN-Organisationen und führte damit die Bestrebungen nach eigenem Staat weiter aus.
Hamas und Fatah einigen sich auf die Bildung einer Einheitsregierung. Der Palästinenserpräsident Mahmud Abbas vereidigt Übergangsregierung. Israel erkennt die Übergangsregierung jedoch nicht an.
Der Tod eines arabischen Jugendlichen und die Tode dreier israelischer Jungen wurden zum Auslöser einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen dem israelischen und palästinensischen Militär. Die Hamas und militante palästinensische Gruppen feuerten Raketen vom Gazastreifen Richtung Israel. Israels Militär reagiert mit Luftangriffen und starteten Bodenoffensive in Gaza.
Es kam zum erneuten Beschuss militärischer Ziele im Gazastreifen durch israelische Kampfflugzeuge.
Militante palästinensische Gruppen feuerten Raketen auf israelisches Gebiet ab. Das israelische Militär antwortet mit Gegenbeschuss. Dabei werden die Grenzübergänge zum Küstenstreifen geschlossen.
Zwei Palästinenser schossen in einem Café in Tel Aviv. Einer der Attentäter wurde von einem Wachmann angeschossen und festgehalten, der Zweite floh und versteckte sich aus Versehen im Haus eines Polizisten.
Jerusalem gilt als heiliger Ort für das Christentum, den Islam und das Judentum. Deshalb ist die Stadt sowohl für Israelis und Palästinenserinnen und Palästinenser sehr bedeutend. Am 6. Dezember 2017 erkannte der damalige US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt des Staates Israel an und veranlasste, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Doch das war für die palästinensische Seite nicht akzeptabel, wodurch Trump die Friedensverhandlungen gefährdete.
Die Hamas rief zu Protesten und dem Marsch der Rückkehr auf. Mit diesen Protesten wollten die Hamas den Anspruch auf ein „Rückkehrrecht“ der Palästinenserinnen und Palästinenser auf das Gebiet des israelischen Staates untermauern.
Die Golanhöhen sind ein gebirgiger Landstrich zwischen Israel und Syrien. Das Gebiet wurde im Sechstagekrieg 1967 von Israel besetzt und 1981 übernommen, was bis heute völkerrechtlich nicht anerkannt ist. Der Streit zwischen Syrien und Israel um die Golanhöhen gehört bis heute zu einem der schwierigsten Punkte bei Friedensverhandlungen im Nahostkonflikt.
Am 28. Januar 2020 stellen US-Präsident Donald Trump und Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in Washington einen Plan für eine Zweistaatenlösung vor. Die palästinensische Seite wurde in die Planung nicht eingebunden und lehnte das Vorhaben ab.
In Anwesenheit des US-Präsidenten Donald Trump unterzeichneten im Weißen Haus der israelische Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) Abdullah bin Zayid Al Nahyan einen gemeinsamen Friedensvertrag.
Im Mai 2021 eskalierte erneut ein Konflikt zwischen Israel und Palästina. Die Hamas stellte Israel ein Ultimatum, seinen Einsatz zu beenden. Die Hamas feuerten nach Ablauf des Ultimatums Raketen auf Israel ab. Daraufhin antwortete Israel mit Angriffen auf militärische Ziele im Gazastreifen. Erst nach 11 Tagen wurde eine Waffenruhe beschlossen, wobei sich beide Seiten zum Sieger erklärten.
Die militante Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad (PIJ)
droht Israel mit Raketenangriffen. Daraufhin griff das israelische Militär den Gazastreifen an und tötete einen Befehlshaber der Organisation. Der Islamische Dschihad kündigte Vergeltungsmaßnahmen an.
Auf Vorschlag ägyptischer Vermittlerinnen und Vermittlern wurden die Angriffe zwischen der israelischen und der palästinensischen Seite beendet.
Am 13. September 1993 wurde die erste Friedensvereinbarung, Oslo I genannt, des Oslo-Friedensprozesses (1993-2000) zwischen Israel und Palästina unterzeichnet. Mit der Vereinbarung erkannten sich beide Staaten zum ersten Mal an. Bei diesem wichtigen Ereignis waren viele politische Vertreterinnen und Vertreter anwesend.
Für ihre Bemühungen um einen Frieden zwischen Israel und Palästina erhielten Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin , Jassir Arafat, der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation sowie der israelische Außenminister Schimon Peres 1994 den Friedensnobelpreis. Nach dem Tod von Jitzchak Rabin am 4. November 1995 gerieten die Friedensverhandlungen ins Stocken, bis sie im Jahr 2000 mit Beginn der zweiten Intifada ganz scheiterten.
Ministerpräsident Israel
Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika
Außenminister Russland
Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina
Am 13. September 1993 wurde die erste Friedensvereinbarung, Oslo I genannt, des Oslo-Friedensprozesses (1993-2000) zwischen Israel und Palästina unterzeichnet. Mit der Vereinbarung erkannten sich beide Staaten zum ersten Mal an. Bei diesem wichtigen Ereignis waren viele politische Vertreterinnen und Vertreter anwesend.
Für ihre Bemühungen um einen Frieden zwischen Israel und Palästina erhielten Israels Ministerpräsident Jitzchak Rabin , Jassir Arafat, der Vorsitzende der Palästinensischen Befreiungsorganisation sowie der israelische Außenminister Schimon Peres 1994 den Friedensnobelpreis. Nach dem Tod von Jitzchak Rabin am 4. November 1995 gerieten die Friedensverhandlungen ins Stocken, bis sie im Jahr 2000 mit Beginn der zweiten Intifada ganz scheiterten.
Jitzchak Rabin
Ministerpräsident
Israel
Jassir Arafat
Vorsitzender der Palästinensischen Befreiungsorganisation
William „Bill“ Clinton
Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika
Warren Christopher
Außenminister
der Vereinigten Staaten von Amerika
Andrei Kosyrew
Außenminister
Russland
Was ist israelbezogener Antisemitismus?
Zum AnfangWo legitime Kritik endet und Antisemitismus beginnt
Wo legitime Kritik endet und Antisemitismus beginnt

Wo endet legitime Kritik am Staat Israel und wo beginnt israelbezogener Antisemitismus?
Ab wann Kritik oder israelbezogene Aussagen antisemitisch sind, kann man in einem ersten Schritt etwa durch den sogenannten 3D-Test prüfen, der von dem israelischen Politiker Natan Scharanski entwickelt wurde.
Dieser legt die folgenden drei Kriterien fest:
Doppelstandards, Delegitimierung und Dämonisierung.
Doppelstandard meint, dass Israel mit anderen Maßstäben als jedes andere Land gemessen wird. Keinem anderen Land würde man beispielsweise das Recht absprechen, sich zu verteidigen, wenn es angegriffen wird. Israel wird der Vorwurf seit seiner Staatsgründung gemacht.
Delegitimierung meint, Israel das Recht abzusprechen, als unabhängiger Staat zu existieren. Jüdinnen und Juden wird verwehrt in diesem Staat sicher und gleichberechtigt zu leben.
Dämonisierung meint, wenn der Staat Israel als das ultimative Böse dargestellt wird. So wird der Zionismus mit dem Faschismus gleichgesetzt oder die israelische Politik mit dem Nationalsozialismus gleichgesetzt.
IHRA-Kriterien
IHRA-Kriterien

Der Vorwurf gegenüber den Jüdinnen und Juden als Volk oder dem Staat Israel, den Holocaust zu erfinden oder übertrieben darzustellen.
Der Vorwurf gegenüber Jüdinnen und Juden, sie fühlten sich dem Staat Israel oder angeblich bestehenden weltweiten jüdischen Interessen stärker verpflichtet als den Interessen ihrer jeweiligen Heimatländer.
Das Aberkennen des Rechts des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung, z. B. durch die Behauptung, die Existenz des Staates Israel sei ein rassistisches Unterfangen.
Die Anwendung doppelter Standards, indem man von Israel ein Verhalten fordert, das von keinem anderen demokratischen Staat erwartet oder gefordert wird.
Das Verwenden von Symbolen und Bildern, die mit traditionellem Antisemitismus in Verbindung stehen (z. B. der Vorwurf des Christusmordes oder die Ritualmordlegende), um Israel oder die Israelis zu beschreiben.
Vergleiche der aktuellen israelischen Politik mit der Politik der Nationalsozialisten.
Das kollektive Verantwortlichmachen von Jüdinnen und Juden für Handlungen des Staates Israel.
Alle IHRA-Kriterien findes du hier
documenta fifteen
documenta fifteen

Die Documenta ist eine Ausstellung für zeitgenössische Kunst. Sie findet alle fünf Jahre für 100 Tage in Kassel statt. Das Besondere ist, dass die Ausstellung immer von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern kuratiert wird. Diese dürfen also entscheiden, welche Kunstwerke ausgestellt werden. Im Jahr 2022 fand die Documenta zum fünfzehnten Mal statt. Kuratorinnen und Kuratoren waren Mitglieder des indonesischen Kollektivs ruangrupa. Die Auswahl der Kunstwerke durch ruangrupa sorgte für einen öffentlichen Skandal, denn einige der Ausstellungsstücke zeigten eine israelfeindliche und antisemitische Bildsprache.
Zur Eröffnung der Documenta 15 hielt der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine kritische Rede. In dieser erklärt er den Unterschied zwischen Kunst- und Meinungsfreiheit und israelbezogenem Antisemitismus:
„Kunst darf anstößig sein, sie soll Debatten auslösen. Mehr noch: Die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Kunst sind Wesenskern unserer Verfassung. Kritik an israelischer Politik ist erlaubt. Doch wo Kritik an Israel umschlägt in die Infragestellung seiner Existenz, ist die Grenze überschritten.
Es fällt auf, wenn auf dieser bedeutenden Ausstellung zeitgenössischer Kunst wohl keine jüdischen Künstlerinnen oder Künstler aus Israel vertreten sind. Und es verstört mich, wenn weltweit neuerdings häufiger Vertreter des globalen Südens sich weigern, an Veranstaltungen, an Konferenzen oder Festivals teilzunehmen, an denen jüdische Israelis teilnehmen.
Ein Boykott Israels kommt einer Existenzverweigerung gleich. Wenn unabhängige Köpfe aus Israel unter ein Kontaktverbot gestellt werden; wenn sie verbannt werden aus der Begegnung und dem Diskurs einer kulturellen Weltgemeinschaft, die sich ansonsten Offenheit und Vorurteilsfreiheit zugutehält; dann ist das mehr als bloße Ignoranz. Wo das systematisch geschieht, ist es eine Strategie der Ausgrenzung und Stigmatisierung, die dann auch von Judenfeindschaft nicht zu trennen ist.“
Politische Ideologien gegen den Staat Israel
Zum Anfang Zum Anfang#israelkritisch – Antisemitismus in sozialen Medien
Zum AnfangLaut einer ARD/ZDF-Onlinestudie von 2020 nutzen 65 Prozent der 14- bis 29-Jährigen Instagram. Dabei wird das Netzwerk nicht nur zur Unterhaltung, sondern auch zur politischen Bildung genutzt.
Antidemokratische Akteurinnen und Akteure nutzen Instagram, um ihre Ideologien zu verbreiten und neue Anhängerinnen und Anhänger zu finden.
Nutzerinnen und Nutzer rufen andere Nutzerinnen und Nutzer dazu auf, sich eindeutig zum Nahostkonflikt oder Israel zu positionieren. Unscheinbare Hashtags wie #freepalestine oder #bds werden unter vermeintlich objektive Beiträge gesetzt. Eine unkritische Nutzung der Plattform kann dazu führen, dass israelfeindliche Inhalte weiterverbreitet und antisemitische Narrative verinnerlicht werden. Denn einen komplexen Konflikt auf wenige Zeichnen zu reduzieren, führt unweigerlich dazu, dass wichtige Fakten und Informationen ungesagt bleiben.
Die chinesische Plattform TikTok ist vor allem unter jungen Nutzerinnen und Nutzern zwischen 16 und 24 Jahren beliebt.
Im Zuge des Israel-Gaza-Konflikts 2021 verbreiteten sich tausende pro-palästinensische und gleichzeitig israelfeindliche Memes, Lieder und Sketche. Getarnt als vermeintliche „Israelkritik“ drückte sich die „Palästinensersolidarität“ mit dem Hashtag #PLM (Palestinian Lives Matter) aus. Außerdem gab es zahlreiche Beiträge, die die israelische Politik mit jener der Nationalsozialisten oder mit Apartheitsregimen verglichen.
Die Kombination der Hashtags, die eine Israelfahne und einen Schuh zeigen, wurde über 1,8 Millionen Mal aufgerufen. In der arabischen Welt gilt der Schuh als Symbol äußerster Verachtung und Erniedrigung.
DREI TIPPS Wie du israelbezogenem Antisemitismus in sozialen Medien begegnen kannst
DREI TIPPS Wie du israelbezogenem Antisemitismus in sozialen Medien begegnen kannst

- Israelbezogenen Antisemitismus erkennen
Wird etwas über Israel oder den Nahostkonflikt gepostet, dann sollte man immer die 3-D-Regel anwenden, um zu prüfen, ob sich in den Inhalten israelfeindliche und antisemitische Aussagen verstecken. - Israelfeindlichen und antisemitischen Äußerungen widersprechen
Erkennt man israelfeindliche und antisemitische Aussagen, dann sollte man unbedingt den Beitrag melden oder ihm in Kommentaren widersprechen. So kann man andere Nutzerinnen und Nutzer auf die Hassinhalte aufmerksam machen. - Inhalte nicht einfach weiterverbreiten
Ein emotionales Bild oder ein emotionaler Text können dazu verleiten, einen Beitrag unkritisch zu teilen. Darum sollte immer genau geprüft werden, wie der Inhalt zu verstehen ist. Hier gilt es also, den ersten Tipp anzuwenden. Falls man sich unsicher ist, dann kann man auch seine Eltern oder Lehrerinnen und Lehrer dazu befragen.
„Was tun? Antisemitismus auf Social Media“
Ein Podcast der Bildungsstätte Anne Frank
Über den Raum
Zum AnfangKulturelles Leben
Zum AnfangJiddisch – Tausend Jahre alt und immer noch lebendig
„Geschäfd is Geschäfd. Doh hilfd kinn Geseire nid.“
„Das Geschäfd is mäh nidd ganz koscher.“
„Die Pohre hodd ne Magge“ (Die Kuh hat einen Mangel.)
„Ne Schbanne Hanneln is besser als ne Elle Malochen“ (Eine Handbreit Handeltreiben bringt mehr als eine Ellenbogenlänge Arbeiten.)
Im Viehhandel auch: übervorteilen
„Bin ich meschugge?“
Im Viehhandel rhetorische Frage als Ablehnung eines überhöhten Preises.
Moos für „Geld“; „Ohne Moos – nix los.“
Ohne Bargeld keine Geschäfte (zwischen uns).
„Mach kinn Schduss nidd.“
„Doh hommäh den Schlammassel.“
„Dähme sin Schmus is Schmonzes.“
„Häh is schoofel.“
(Er ist ein gemeiner Kerl.)
„Wo Schmus nidd hilfd, mußde n Mull voll schwaddsen, on zwar Tacheles.“
(Wo gutes Zureden nicht hilft, da musst du deine Meinung sagen, und zwar unverblümt.)
„Kaufsde n Goldschdigge oder kaufsde Dinneff?“
„Mach kinn Zoores nid.“
(Bereite keine Schwierigkeiten.)
beschommeleh: betrügen, jemanden täuschen
betuach: wohlhabend, vermögend
gesejre, geseira: Verhängnis, Gejammer
„Geschäfd is Geschäfd. Doh hilfd kinn Geseire nid.“
kaschar: rein, einwandfrei
„Das Geschäfd is mäh nidd ganz koscher.“
makkah: Schlag, Mangel, Fehler
„Die Pohre hodd ne Magge“ (Die Kuh hat einen Mangel.)
melochoh: arbeiten
„Ne Schbanne Hanneln is besser als ne Elle Malochen“ (Eine Handbreit Handeltreiben bringt mehr als eine Ellenbogenlänge Arbeiten.)
maschal, mauschel: An Beispielen erläutern, mit den Händen reden, undurchsichtige Vereinbarungen treffen.
Im Viehhandel auch: übervorteilen
meschuggoh: wahnsinnig, verrückt
„Bin ich meschugge?“
Im Viehhandel rhetorische Frage als Ablehnung eines überhöhten Preises.
moaus = Groschen,
Moos für „Geld“; „Ohne Moos – nix los.“
Ohne Bargeld keine Geschäfte (zwischen uns).
sachrn: handeln
schtut: Dummheit
„Mach kinn Schduss nidd.“
schlimm-massol: Unglück
„Doh hommäh den Schlammassel.“
schmonze: alberne Geschichte
„Dähme sin Schmus is Schmonzes.“
safal: schlecht, gemein
„Häh is schoofel.“
(Er ist ein gemeiner Kerl.)
schemuoth: Gerede, Schmeichelei
tachlut: Ziel, Zweck
„Wo Schmus nidd hilfd, mußde n Mull voll schwaddsen, on zwar Tacheles.“
(Wo gutes Zureden nicht hilft, da musst du deine Meinung sagen, und zwar unverblümt.)
tinnuf: Schmutz, Schund
„Kaufsde n Goldschdigge oder kaufsde Dinneff?“
mossar: verpfuschen
sussim: Pferde
zaar: Schwierigkeiten, Zank
„Mach kinn Zoores nid.“
(Bereite keine Schwierigkeiten.)
Jüdische Kulturwochen in Hessensingen, tanzen, quasseln, hören, gucken!

Ausrichter jüdischer Kulturwochen sind die jüdischen Gemeinden und andere jüdische Institutionen in Hessen in Partnerschaft mit den jeweiligen Städten.
Warum jüdische Kulturwochen?
Warum jüdische Kulturwochen?

Im Gespräch mit Daniel Neumann, Direktor des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden in Hessen

... weil der Jude als das unbekannte Wesen dadurch vielleicht etwas greifbarer wird. Um sichtbar, erlebbar und spürbar werden zu lassen, dass dieses Wesen, das nur allzu gerne in Schwarz-Weiß-Tönen gemalt wird, in Wirklichkeit farbenfroh und vielschichtig ist.
Denn trotz aller Vorurteile, trotz aller verschrobener Vorstellungen und trotz aller Verschwörungsmythen, die dort draußen kursieren, ist dieses Wesen vor allem eines: nämlich nicht so! Meistens jedenfalls nicht.
Und erst recht ist es nicht durch einseitige, simple oder wahnhafte Zuschreibungen erfassbar, sondern ist stattdessen eher wie das Licht, das sich in einem Prisma bricht und sich in tausende Farben vervielfacht.
Um auch nur einen Hauch dieser Farbvielfalt zu erhaschen, präsentieren wir ein buntes Programm, das Diskussionen, Geschichte, Musik, Literatur, Religion, Humor und vieles mehr umfasst. Und das manch fröhliches, melancholisches, erkenntnisreiches, kurzweiliges, spannendes oder entspanntes Erlebnis beschert.
Textquelle: Jüdische Kulturwoche Darmstadt 2022

Ausstellungsraum 6
Alltag & Begegnung
Ein persönlicher Austausch bewirkt, was hundert Bücher nicht leisten könnenNice to meet Jew!
„Triff einen Juden“ funktioniert so:
Man fragt auf der Projektwebseite eine Begegnung für eine Gruppe an. Daraufhin kommen zwei jüdische Ehrenamtliche zum Beispiel in eine Schulklasse. Dort wird dann erzählt, gefragt, geantwortet: ganz informell, unkompliziert und auf Augenhöhe. Es geht nicht um Geschichte und „Lernstoff“, sondern um individuelle Lebenswelten und den persönlichen Alltag von Jüdinnen und Juden mit seinen vielfältigen Gesichtern und Perspektiven.
Der Verein bringt jüdische und nichtjüdische Sportlerinnen und Sportler zusammen. Makkabi schafft einen offenen und toleranten Raum, in dem sich verschiedene Kulturen begegnen, kennen lernen und voneinander lernen können.
Alle sollen die Möglichkeit erhalten, an den Sportangeboten teilzunehmen. Der Verein unterstützt finanziell weniger gut ausgestattete Mitglieder bei den Beitragszahlungen.
Sport als Werkzeug, um Brücken zu bauen: Makkabi wendet sich gegen Antisemitismus, Rassismus und jegliche Art von Diskriminierung. Die Initiative ZUSAMMEN1 forscht nach den Ursachen von Hass und Hetze und bietet konkrete Lösungen an.
Abseits des Sportplatzes geht auch etwas: Makkabi Deutschland e.V. bietet auch Kulturevents an, um jüdisches Leben vorzustellen: Synagogen-Führung, Musik, festliches Schabbat-Essen und traditionelles Kerzenanzünden.
TuS Makkabi Frankfurt 1965 e.V. ist ein jüdischer Turn- und Sportverein, der für alle Menschen seine Türen öffnet. Der Verein zählt mittlerweile über 3.000 Mitglieder, bietet 32 verschiedene Sportarten an und ist Teil der deutschlandweiten
Makkabi-Familie.
Sport verbindet
Der Verein bringt jüdische und nichtjüdische Sportlerinnen und Sportler zusammen. Makkabi schafft einen offenen und toleranten Raum, in dem sich verschiedene Kulturen begegnen, kennen lernen und voneinander lernen können.
Solidarität
Alle sollen die Möglichkeit erhalten, an den Sportangeboten teilzunehmen. Der Verein unterstützt finanziell weniger gut ausgestattete Mitglieder bei den Beitragszahlungen.
Haltung zeigen: Initiative ZUSAMMEN1
Sport als Werkzeug, um Brücken zu bauen: Makkabi wendet sich gegen Antisemitismus, Rassismus und jegliche Art von Diskriminierung. Die Initiative ZUSAMMEN1 forscht nach den Ursachen von Hass und Hetze und bietet konkrete Lösungen an.
Grenzen überwinden
Abseits des Sportplatzes geht auch etwas: Makkabi Deutschland e.V. bietet auch Kulturevents an, um jüdisches Leben vorzustellen: Synagogen-Führung, Musik, festliches Schabbat-Essen und traditionelles Kerzenanzünden.
Kulinarik
Kultur geht durch den Magen
Doch wie sieht eine „typisch jüdische“ Küche eigentlich aus?
Die Antwort ist gar nicht so einfach.
Viele denken bei jüdischer Esskultur an die jüdischen Speisegesetze, also koscheres Essen. Das ist richtig – aber nicht alle Jüdinnen und Juden ernähren sich koscher.
Andere denken bei jüdischer Küche eher an die israelische Küche. Immerhin ist diese seit einigen Jahren ein wahrer Foodtrend und wird immer beliebter.
Die ursprüngliche regionale Küche Israels ist die der Levante, des östlichen Mittelmeers – und diese ist stark von der arabischen Küche geprägt. Da die jüdische Bevölkerung in Israel ihre Wurzeln in Europa, Russland und vielen anderen Ländern des Nahen Ostens oder Nordafrika hat, brachten die eingewanderten Jüdinnen und Juden ihre Landesküche in die neue Heimat Israel mit. So sind ungarische Rezepte oder spanische Gerichte, Backwerk aus Deutschland oder Einflüsse aus Ägypten klassischer Bestandteil israelischer Kulinarik.
Die jüdische oder israelische Küche spiegelt daher auch den jungen, multiethnischen Staat Israel wider. Wenn wir die jüdische Küche in Hessen kennen lernen wollen, werden wir sehr wahrscheinlich kulinarischen Inspirationen aus aller Welt begegnen.
Wusstest du?
Ein wichtiger Grundsatz ist: Za’ar Ba’alei Chajim
Es ist verboten, Tieren unnötig Leid zuzufügen.
Koscheres Essen ist aus diesem Grund häufig auch vegan, denn Obst, Gemüse und Getreide gelten als neutral.
Israel entwickelt sich entsprechend auch als Hotspot für Veganismus.
Ohne Hummus geht nichts!
Ein Teller Hummus mit Pita!
„Wenn du dich in Israel mit einem Freund triffst, dann fragst du ihn, ob er mit dir ‚Hummus wischen‘ möchte. [..] Hummus gehört bei uns zur Kultur. Ich kenne keinen in Israel, der das nicht täglich isst. Mir hat das Hummus in Deutschland gefehlt.“ So beschreibt Miki Lev-Ari, Gastronom aus Frankfurt, die Bedeutung des kulinarischen Kulturgutes des Nahen Ostens.
Hummus ist eine Kichererbsencreme mit Sesampaste, Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft, Salz und Gewürzen. Es ist vielleicht die Speise des Nahen Ostens. Dass sie köstlich ist, darüber sind sich selbst Israelis und Araber einig. Doch wer hat’s erfunden, Juden oder Araber? Das weiß niemand.
Koscher einkaufen
In Hessen gibt es sogar Supermärkte, die sich auf die koschere Ernährungsweise spezialisiert haben: Waren aus Israel, heimische Lebensmittel, Frischwaren, typische Gewürze und Besonderheiten für jüdische Feiertage – alle Produkte haben ein „Koscher Siegel“.
Aber auch in allen anderen Supermärkten finden sich koschere Lebensmittel. Im Internet kann man sogenannte „Koscherlisten“ finden, auf denen werden alle Lebensmittel aufgeführt, die von Rabbinerinnen und Rabbinern geprüft und als koscher befunden wurden.
Koscheres Essen ist auch für nichtjüdische Personen interessant, die sich bewusst ernähren wollen. Koscheres Fleisch darf beispielsweise nicht aus Massentierhaltung stammen und muss von hoher Qualität sein.
Religion & Tradition
Gemeinschaft. Vielfalt. Offenheit.Jüdische Religion und Tradition in Hessen heute
Dieser selbstironische jüdische Witz hat einen historischen und aktuellen Bezug. Denn die jüdische Religion wird und darf immer wieder hinterfragt und neu ausgelegt werden. Dadurch entstehen lebhafte Diskussionen und es gibt entsprechend viele religiöse Strömungen im Judentum. Und diese Strömungen sind fließend: Jemand kann sich zwar einer bestimmten religiösen Ausrichtung zugehörig fühlen. Das heißt aber nicht, dass die oder derjenige sich an alle Riten und Bräuche hält, die diese Auslegung vorschreibt.
Es gibt auch viele säkulare, nichtreligiöse Jüdinnen und Juden. Viele von ihnen feiern die religiösen Feste gerne nach traditionellen Bräuchen. Für sie sind es dann eher schöne Familienfeste, die ein Gefühl der Gemeinschaft und Zugehörigkeit vermitteln.
Das Judentum ist eine Religion der Tat. Deshalb gibt es viele Rituale, die an jüdischen Feiertagen durchgeführt werden. Willst du mehr über jüdische Bräuche und Traditionen erfahren, dann schau doch mal in dieses Exponat.
Kehillah Jüdische Gemeinden in Hessen
Die Kehillot sind das Zentrum einer jüdischen Gemeinde und für viele auch das Herz der jüdischen Community. Die Selbstverwaltung der jüdischen Gemeinschaften war und ist immer noch von immens hoher Bedeutung für die Jüdinnen und Juden in der Diaspora, der Zerstreuung außerhalb des Heiligen Landes.
Die Kehillah ist die heilige Gemeinde und religiöses Zentrum mit einer oder mehreren Synagogen. Ihr angegliedert sind häufig auch Einrichtungen der Sozial-, Bildungs-, Armen- und Krankenfürsorge und andere Kultureinrichtungen. Die Jüdische Gemeinde repräsentiert die Community zudem nach außen und organisiert Treffen der Gemeindemitglieder. In ihrem Selbstverständnis betonen die Jüdischen Gemeinden in Hessen die Vielfalt jüdischen Lebens und sind auch für säkulare Einflüsse, also nicht rein religiöse Lebensbereiche, offen.
Egalitärer Minjan
Im liberalen Judentum, auch Reformjudentum genannt, gibt es eine egalitäre Strömung, bei der Frauen und Männer gleichberechtigt gezählt werden. Diese Form einer liberalen jüdischen Synagogengemeinschaft heißt Egalitärer Minjan.
In der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main gibt es einen Egalitären Minjan. Dieser wird von einer Rabbinerin geleitet.
Ein Blick hinter die Kulissen
Durch einen Blick hinter die Kulissen erfahren wir mehr über das Gotteshaus von Jüdinnen und Juden, die jüdische Religion, über Gebetbücher und Gebete, die Bedeutung der Thora, das ewige Licht und die Menora.
Noch mehr entdecken?
Hier gehts zur virtuellen Ausstellung der Jüdischen Gemeinde Hanau: Link
Die Westend-Synagoge in FrankfurtÜberleben und neu erstehen
Die Westend-Synagoge ist das größte jüdische Gotteshaus Frankfurts. Sie bietet verschiedenen Richtungen innerhalb der Jüdischen Gemeinde ein Zuhause. Wie alle Synagogen ist auch sie keine reine Gottesdienststätte. Es gibt eine Bibliothek, Lehrräume und Sozialräume für Begegnungen und gemeinschaftliches Miteinander. Gleich neben der Westend-Synagoge liegt die Jüdische Volkshochschule Frankfurt.











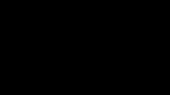
























































































































































































 Eingangsbereich
Eingangsbereich
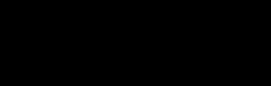 Impressum
Impressum
 Antisemitismus war in Deutschland nie verschwunden
Antisemitismus war in Deutschland nie verschwunden
 Antisemitische Vorfälle der letzten Jahre
Antisemitische Vorfälle der letzten Jahre
 Antisemitische Straftaten
Antisemitische Straftaten
 Wie antisemitisch ist Deutschland?
Wie antisemitisch ist Deutschland?
 Wie äußert sich Antisemitismus?
Wie äußert sich Antisemitismus?
 Terroranschlag in Halle
Terroranschlag in Halle
 Das Wichtigste ist, dass wir keine Angst haben
Das Wichtigste ist, dass wir keine Angst haben
 Geschichte des jüdischen Lebens in Hessen
Geschichte des jüdischen Lebens in Hessen
 Was bedeutet es, jüdisch zu sein?
Was bedeutet es, jüdisch zu sein?
 Ein Begriff - viele Vorstellungen
Ein Begriff - viele Vorstellungen
 Antisemitismus heute
Antisemitismus heute
 Wo begegnet Jüdinnen und Juden heute Antisemitismus?
Wo begegnet Jüdinnen und Juden heute Antisemitismus?
 Antisemitismus im Alltag...
Antisemitismus im Alltag...
 ... auf dem Schulhof
... auf dem Schulhof
 ... in der Schule
... in der Schule
 ... auf dem Sportplatz
... auf dem Sportplatz
 Antisemitismus im Rap
Antisemitismus im Rap
 Jüdische Gemeinden
Jüdische Gemeinden
 Judentum weltweit
Judentum weltweit
 War das schon immer so?
War das schon immer so?
 Entwicklung in einzelnen Ländern
Entwicklung in einzelnen Ländern
 Wer glaubt was?
Wer glaubt was?
 Vom Großen zum Kleinen
Vom Großen zum Kleinen
 Wie reagiert man auf Antisemitismus?
Wie reagiert man auf Antisemitismus?
 Austausch fördern
Austausch fördern
 Was kannst du unternehmen?
Was kannst du unternehmen?
 Jüdisches Leben in Hessen
Jüdisches Leben in Hessen
 Jüdische Migrationsbewegungen nach 1945 und 1989
Jüdische Migrationsbewegungen nach 1945 und 1989
 Displaced Persons
Displaced Persons
 Displaced Persons
Displaced Persons
 Zurück nach Deutschland
Zurück nach Deutschland
 Migrationsbewegung nach 1990
Migrationsbewegung nach 1990
 Religiöse Grundlagen
Religiöse Grundlagen
 Die Heilige Schrift
Die Heilige Schrift
 Lernen durch Wiederholung
Lernen durch Wiederholung
 Das Judentum kennt viele Feste
Das Judentum kennt viele Feste
 Jüdische Feiertage
Jüdische Feiertage
 Schabbat
Schabbat
 Bar Mizwa und Bat Mizwa
Bar Mizwa und Bat Mizwa
 Alles eine Verschwörung?
Alles eine Verschwörung?
 Theorie, Erzählung, Mythos oder Ideologie?
Theorie, Erzählung, Mythos oder Ideologie?
 Wie funktionieren Verschwörungserzählungen
Wie funktionieren Verschwörungserzählungen
 Rothschild-Theorie
Rothschild-Theorie
 Sind alle Verschwörungserzählungen antisemitisch?
Sind alle Verschwörungserzählungen antisemitisch?
 Jüdische Erinnerungsorte in Hessen
Jüdische Erinnerungsorte in Hessen
 Das Ostend
Das Ostend
 Battonstraße
Battonstraße
 Rothschildpalais
Rothschildpalais
 Was ist eigentlich jüdisch?
Was ist eigentlich jüdisch?
 Moral und Ethik
Moral und Ethik
 Noachidische Gebote
Noachidische Gebote
 Wie frei ist unser eigener Wille?
Wie frei ist unser eigener Wille?
 Die Bedeutung der Wohltätigkeit
Die Bedeutung der Wohltätigkeit
 "Gutes tun ist Tikkun Olam"
"Gutes tun ist Tikkun Olam"
 Bal Taschchit
Bal Taschchit
 Darf ich Israel kritisieren?
Darf ich Israel kritisieren?
 Palästina erzählt die Geschichte wechselhafter Eroberungen
Palästina erzählt die Geschichte wechselhafter Eroberungen
 Al-Quds-Marsch
Al-Quds-Marsch
 Wann ist Israel-Kritik antisemitisch?
Wann ist Israel-Kritik antisemitisch?
 „Juddebubbe“ – die Eintracht Frankfurt
„Juddebubbe“ – die Eintracht Frankfurt
 Jüdische Sportvereine
Jüdische Sportvereine
 Die Eintracht Frankfurt
Die Eintracht Frankfurt
 Sport im Nationalsozialismus
Sport im Nationalsozialismus
 Die Eintracht im Nationalsozialismus
Die Eintracht im Nationalsozialismus
 1936 Olympia
1936 Olympia
 Jüdische SportlerInnen
Jüdische SportlerInnen
 Neugründung nach 1945
Neugründung nach 1945
 Ist jüdisch gleich jüdisch?
Ist jüdisch gleich jüdisch?
 Das liberale Judentum
Das liberale Judentum
 Das orthodoxe Judentum
Das orthodoxe Judentum
 Judentum, Christentum, Islam
Judentum, Christentum, Islam
 Jüdische Perspektive
Jüdische Perspektive
 Antisemitismus hat Geschichte
Antisemitismus hat Geschichte
 Antisemitismus hat Geschichte
Antisemitismus hat Geschichte
 "Das mutierende Virus"
"Das mutierende Virus"
 Deutsch-jüdische Geschichte
Deutsch-jüdische Geschichte
 Moses Mendelssohn und Israel Jacobson
Moses Mendelssohn und Israel Jacobson
 Kritik an Anpassung
Kritik an Anpassung
 Gustaf Graef Gemälde
Gustaf Graef Gemälde
 Zwischen Anpassung und Ausgrenzung
Zwischen Anpassung und Ausgrenzung
 Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft
Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft
 Christlicher Antijudaismus
Christlicher Antijudaismus
 Titusbogen
Titusbogen
 Schum-Städte
Schum-Städte
 1. Kreuzzug
1. Kreuzzug
 Kleidung
Kleidung
 Frankfurter Judengasse
Frankfurter Judengasse
 Pestpogrome
Pestpogrome
 Jüdischer Geldverleih
Jüdischer Geldverleih
 Alles koscher?
Alles koscher?
 Jüdische Speiseregeln
Jüdische Speiseregeln
 Garantiert koscher
Garantiert koscher
 Entstehung des modernen Antisemitismus
Entstehung des modernen Antisemitismus
 Eine neue Form der Judenfeindschaft
Eine neue Form der Judenfeindschaft
 Antisemitismus im Kaiserreich
Antisemitismus im Kaiserreich
 Die angebliche "jüdische Weltverschwörung"
Die angebliche "jüdische Weltverschwörung"
 Zionismus - eine Reaktion auf den Antisemitismus?
Zionismus - eine Reaktion auf den Antisemitismus?
 Antisemitismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Antisemitismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts
 Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
Reichsbund jüdischer Frontsoldaten
 Machtübernahme Hitlers
Machtübernahme Hitlers
 Nürnberger Gesetze
Nürnberger Gesetze
 Pogromnacht
Pogromnacht
 Flucht vor Antisemitismus
Flucht vor Antisemitismus
 Warschauer Ghetto
Warschauer Ghetto
 Warschauer Ghettoaufstand
Warschauer Ghettoaufstand
 Deportationen
Deportationen
 Auschwitz
Auschwitz
 Völkermord an europäischen Jüdinnen und Juden
Völkermord an europäischen Jüdinnen und Juden
 Todesmärsche
Todesmärsche
 Einstieg in israelbezogener Antisemitismus
Einstieg in israelbezogener Antisemitismus
 Shoah und das Gedenken
Shoah und das Gedenken
 Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland
Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland
 Eichmann-Prozess
Eichmann-Prozess
 Auschwitz-Prozess
Auschwitz-Prozess
 Heutiges Gedenken
Heutiges Gedenken
 Gemeinsamer Wunsch nach einer jüdischen Heimstätte
Gemeinsamer Wunsch nach einer jüdischen Heimstätte
 Die Entstehung des Zionismus
Die Entstehung des Zionismus
 Jerusalem: Die umkämpfte heilige Stadt
Jerusalem: Die umkämpfte heilige Stadt
 Wie lebt es sich in Israel heute?
Wie lebt es sich in Israel heute?
 Glossar
Glossar
 Israelbezogener Antisemitismus
Israelbezogener Antisemitismus
 Zwischen Unabhängigkeit und Katastrophe
Zwischen Unabhängigkeit und Katastrophe
 Die Geschichte der britischen Mandantschaft über Palästina
Die Geschichte der britischen Mandantschaft über Palästina
 Entstehung des Nahostkonflikts
Entstehung des Nahostkonflikts
 Die Chronik des Nahostkonflikts
Die Chronik des Nahostkonflikts
 Meilenstein: Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina
Meilenstein: Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina
 Das Olympia-Attentat
Das Olympia-Attentat
 Glossar
Glossar
 Antisemitismus hat eine lange Geschichte
Antisemitismus hat eine lange Geschichte
 Was ist Antizionismus?
Was ist Antizionismus?
 Islamischen Antisemitismus
Islamischen Antisemitismus
 Wo legitime Kritik endet und Antisemitismus beginnt
Wo legitime Kritik endet und Antisemitismus beginnt
 IHRA-Kriterien
IHRA-Kriterien
 documenta fifteen
documenta fifteen
 Antisemitismusvorwurf: documenta fifteen
Antisemitismusvorwurf: documenta fifteen
 Bildungsstätte Anne Frank
Bildungsstätte Anne Frank
 Handlungsemfehlungen
Handlungsemfehlungen
 Glossar
Glossar
 Antiisraelische Strömungen
Antiisraelische Strömungen
 Ideologisch geprägte "Israelkritik"
Ideologisch geprägte "Israelkritik"
 BDS – ein Boykott gegen Israel
BDS – ein Boykott gegen Israel
 Von links
Von links
 Al-Quds-Marsch
Al-Quds-Marsch
 Glossar
Glossar
 Hass entsteht nicht im Internet, der Hass kommt aus den Köpfen und wird ins Internet getragen
Hass entsteht nicht im Internet, der Hass kommt aus den Köpfen und wird ins Internet getragen
 Under Attack
Under Attack
 Israelbezogener Antisemitismus auf Instagram
Israelbezogener Antisemitismus auf Instagram
 Israelbezogener Antisemitismus auf Tiktok
Israelbezogener Antisemitismus auf Tiktok
 Antisemitische Hasskommentare ohne Konsequenzen?
Antisemitische Hasskommentare ohne Konsequenzen?
 DREI TIPPS
DREI TIPPS
 Einführung ins Thema
Einführung ins Thema
 Einstieg jüdische Kultur
Einstieg jüdische Kultur
 Jiddisch – Tausend Jahre alt und immer noch lebendig
Jiddisch – Tausend Jahre alt und immer noch lebendig
 Jiddisch
Jiddisch
 Lesung in JGF mit Caséz, Donskoy & Zingher
Lesung in JGF mit Caséz, Donskoy & Zingher
 Freitagnacht Jews
Freitagnacht Jews
 Rafael Herrlich
Rafael Herrlich
 Fotografien von Rafael Herlich
Fotografien von Rafael Herlich
 singen, tanzen, quasseln, hören, gucken!
singen, tanzen, quasseln, hören, gucken!
 Warum jüdische Kulturwochen?
Warum jüdische Kulturwochen?
 Jüdisches Leben in Hessen heute
Jüdisches Leben in Hessen heute
 Auf das Leben!
Auf das Leben!
 Joelle, Meet a Jew
Joelle, Meet a Jew
 Nice to meet Jew!
Nice to meet Jew!
 Impressionen Meet a Jew
Impressionen Meet a Jew
 Auf die Ohren!
Auf die Ohren!
 Amichai Frankfurt
Amichai Frankfurt
 Botschaft - Alon Meyer
Botschaft - Alon Meyer
 Makkabi e. V.
Makkabi e. V.
 Normalität mit Sicherheitsstandards
Normalität mit Sicherheitsstandards
 Kultur geht durch den Magen
Kultur geht durch den Magen
 Shakshuka
Shakshuka
 Wusstest du?
Wusstest du?
 Ohne Hummus geht nichts!
Ohne Hummus geht nichts!
 Koscher einkaufen
Koscher einkaufen
 Gemeinschaft. Vielfalt. Offenheit.
Gemeinschaft. Vielfalt. Offenheit.
 Interview mit Dov Aviv
Interview mit Dov Aviv
 Kehillah
Kehillah
 Egalitärer Minjan
Egalitärer Minjan
 Ein Blick hinter die Kulissen
Ein Blick hinter die Kulissen
 Was ist eine Synagoge?
Was ist eine Synagoge?
 Was ist Aron Hakodesh?
Was ist Aron Hakodesh?
 Was bedeutet Menora?
Was bedeutet Menora?
 Die Westend-Synagoge in Frankfurt
Die Westend-Synagoge in Frankfurt